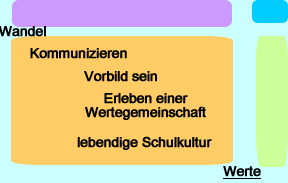Inhalt:
- Problemaufriss: "Mal sehen, ob der Typ echt ist ...."
- Quellen zu: Der Lehrer als Erzieher
- Heinrich Geißler: Der Lehrer: Lehrerrolle, Rollenvielfalt, Rollenkonflikt
- Christian Caselmann: Wesensformen des Lehrers
- Arno Combe: Kritik der Lehrerrolle
- Otto Friedrich Bollnow: Über die Tugend des Erziehers
- Eduard Spranger: Der geborene Erzieher
- Bauer, Kopka &. Brindt: Pädagogische Professionalität und Lehrerarbeit
- Hermann Giesecke: Das Ende der Erziehung
- Rainer Winkel: Die Persönlichkeit des Lehrers
- Hans Christian Thalmann: Den Schulalltag bestehen.
- Reinhard Tausch &. Anne-Marie Tausch : Wesentliche Verhaltensdimensionen von Lehrern, Dozenten, Erziehern in Erziehung und Unterricht
- Kurt Lewin: Die Lösung sozialer Konflikte
- Die Geschichte von Hans Hefeteig
4. Christian Caselmann: Wesensformen des Lehrers - Versuch einer Typenlehre
Die Typenmerkmale
Alles Lehrertum, so sagten wir, hat eine sachliche und
eine persönliche
Seite. Der Lehrer muß sich einmal innerlich seinem Bildungsideal ,
dem Lehrziel und dem Lehrinhalt verpflichtet fühlen. Er muß diese
Dinge nicht nur äußerlich beherrschen, er muß in ihnen geistig
und seelisch verwurzelt sein, muß sich verwachsen fühlen mit seinem
Lehrstoff, muß befähigt sein für seine Mission, diese Kulturinhalte
der jungen Generation nahezubringen, daß auch sie diese Werte ergreife
und von ihnen ergriffen wird. Sehr viele Lehrer schlagen die Lehrerlaufbahn
ein, weil sie schon als werdende junge Menschen innerlich von den Werten
der Kultur begeistert sind, weil sie lebenslang mit diesen Dingen umgehen
wollen. Die Mehrzahl der Lehrer an den höheren Schulen wird zu dieser
Gruppe gehören, aber auch ein großer Prozentsatz der Volksschullehrer
zählt zu ihr. Wie viele Bauern- und Handwerkersöhne, die hervorragende
Lehrergestalten geworden sind, haben diesen Beruf ergriffen oder sind von
ihren Lehrern dazu ausgesucht und bestimmt worden, nur weil sie als Schulbuben
eine besondere Fähigkeit und ein den Durchschnitt überragendes
Interesse an den Gegenständen des Unterrichts zeigten!
Wissens- und Wissenschaftsdrang zeichnet diese jungen Menschen vor anderen
aus. Wir nennen diese Typengruppe logotrop, d.h. der Wissenschaft,
der Kultur zugewendet. Den logotropen Lehrern geht es in erster Linie um
Bildungsideal und Bildungsziel, um positives Wissen und Können , um
den Lehrstoff, um die Weckung der Begeisterung bei der Jugend für die
Kulturwerte. Bei aller Unterrichts- und Erziehertätigkeit liegt für
sie das Schwergewicht, der Hauptakzent, auf den objektiven Werten, an denen
die jungen Menschen sich emporbilden sollen. Diese Kulturwerte sind also
Ausgangspunkt und Zielpunkt ihres Lehrertums.
Bei genauerem Zusehen zerfällt die Gruppe der Logotropen in zwei Untergruppen: in
die philosophisch Interessierten und in die fachwissenschaftlich Interessierten.
Für die philosophisch Interessierten ist die von ihnen ergriffene Wissenschaft
in erster Linie Baumaterial für die eigene Lebens- und Weltanschauung.
Es geht ihnen schließlich immer um die letzten Wahrheiten, um Gott
und Welt, um Sein und Schein , um Gesetz und Freiheit, um Ich und Gemeinschaft. An
diese Fragen wollen sie auch letztlich ihre Schüler heranführen,
und wenn sie das nicht können wegen des noch zu unreifen Alters der
Schüler, dann ist doch ihr ganzer Unterricht aus philosophischen Grundüberzeugungen
gespeist und von ihnen durchwaltet. ...
Ihr Unterricht wird sich stets durch eine gewisse wohltätige Geschlossenheit
auszeichnen und daher oft große Wirkung haben.
Beispiele (siehe Vorwort) mögen das veranschaulichen.
„Seine Gesichtszüge sind fast dauernd straff angespannt, als ob er immerzu denke oder grüble. Die griechische Philosophie hat es ihm angetan, und sie beschäftigt ihn auf Schritt und Tritt. Immer wieder setzt er sich mit ihr und der christlichen Ethik auseinander, und es ist schwer zu entscheiden, welche der beiden Denkarten ihn mehr zu dem gemacht hat, was er ist. Wie von sich verlangt er auch von seinen Schülern unbedingte Selbstzucht. Das fängt schon beim Lesen des lateinischen oder griechischen Textes an. Auch nicht ein unbedeutend scheinendes Wörtchen darf beim Übersetzen außer acht gelassen werden. ‘Es ist eine Frage der Ehrfurcht’, pflegt er dabei zu sagen. So will er Grundlagen schaffen, auf denen später weitergebaut werden kann.“
In ihrem Fach möchten sie bis an die Grenzen des Wissens schreiten,
alles ist ihnen wichtig und interessant. Sie imponieren als Lehrer der Jugend
durch ihr Können und Wissen und reißen sie durch ihre Begeisterung
für die Gegenstände des Unterrichts mit fort. Wenn sie auch nicht
so ins Grundsätzlich-Philosophische gehen und nicht so in die Tiefe
graben, so lernt man doch bei ihnen viel und leicht; sie erzielen daher erstaunliche
Unterrichtserfolge. Wie von den philosophisch Interessierten geht auch von
ihnen eine Begeisterung für die von ihnen vertretenen Fächern aus.
Sie haben keinen so unmittelbaren persönlichen erzieherischen Einfluß;
aber ihre unterrichtliche Wirkung ist vielleicht dafür größer,
und indirekt wirken sie so durch die den Stoffen innewohnenden Bildungselemente
doch auch in nicht geringem Maß erzieherisch. Man findet bei ihnen
nicht nur überwiegend Naturwissenschaftler, sondern auch Geographen,
Historiker und Neussprachler. Wirkten die philosophisch Interessierten durch
ihre Geschlossenheit, so fesseln die fachlich Interessierten durch die Vielseitigkeit.
Sie, die in der ganzen Weite ihres Faches zu Hause sind, zeigen immer wieder
neue, unbekannte Seiten, beleuchten ihren Gegenstand von den verschiedensten
Punkten. Sie sind im allgemeinen der Außenwelt mehr zugewendet als
die philosophisch Interessierten.
Sie verlassen sich daher nicht nur auf die magnetisch wirkende Kraft ihres
Stoffes, sondern werben für ihn; so sind sie oft auch von ihrem Stoff
her methodisch interessiert. Sie machen mit ihren Schülern Schulausflüge,
opfern für Arbeitsgemeinschaften, Besuche von Museen, Galerien und dergleichen
ihre freie Zeit, sie ziehen einzelne Schüler oder Schülergruppen
zur Mitarbeit in Laboratorien und auf wissenschaftlichen Exkursionen (beim
Botanisieren, Raupen-, Käfersammeln und dergl.) heran; sie helfen ihnen
Herbarien oder andere Sammlungen anlegen, nehmen sie auf Spaziergänge
mit und lehren sie die Vogelstimmen und Pflanzen kennen. Das alles tun sie
aber nicht so sehr aus Liebe zur Jugend wie aus der Erfülltheit und
Begeisterung für ihre Sache. Ihr großes Wissen und ihr Aufgehen
in ihrem Fach imponiert der Jugend und reißt sie mit.
Dem logotropen Flügel, der die sachliche Seite des Lehrertums vertritt,
steht nun der paidotrope Flügel, der das persönliche Element darstellt,
gegenüber. Paidotrop, d.h. dem Kinde zugewandt, sind
diejenigen Lehrer, die in erster Linie nicht an den Stoff, sondern an das
Kind denken. Von vornherein, anlagemäßig, lockte sie weniger die
Wissenschaft als die Tätigkeit des Erziehens und Unterrichtens. Der
Umgang mit jungen Menschen ist ihnen ebenso Herzensbedürfnis wie den
Logotropen die Beschäftigung mit der Wissenschaft. In ihnen ist nicht
der wissenschaftliche, sondern der eigentlich pädagogische Eros lebendig.
Während die logotropen Lehrer sich für unterrichtliche Fragen,
sei es, daß es sich um die Stoffauswahl oder um methodische Probleme
handelt, immer vorzugsweise unter dem Gesichtspunkt des Stoffes interessieren,
kommen die paidotropen Lehrer an all diese Unterrichtsfragen vom Blickwinkel
des Kindes aus heran. Die Logotropen wollen in erster Linie in der Schule
unterrichten, den Paidotropen ist es vor allem um Erziehung zu tun. Wenn
bei den Paidotropen wissenschaftliches Interesse lebendig wird, wendet es
sich in erster Linie jugendpsychologischen Fragen zu.
Auch bei den Paidotropen finden wir zwei Untergruppen: die individuell-psychologisch
Interessierten und die generell-psychologisch Interessierten.
Die erste Gruppe, die der individuell-psychologisch Interessierten, wendet
sich in erster Linie dem einzelnen Schüler zu. Diese Lehrer wollen jeden
Schüler möglichst genau kennen und verstehen lernen. Sie bemühen
sich, jeden Schüler mit all seinen Fehlern und Schwächen liebend
zu umfassen, seiner Individualität gerecht zu werden, sein persönliches
Vertrauen zu gewinnen und so den erzieherischen Ansatzpunkt zu finden, der
die Voraussetzung für die unterrichtliche Arbeit und ihren Erfolg ist.
„Es war nicht so sehr ihr Unterricht, der uns fesselte, als ihre Persönlichkeit.
In ihrer Art lag das Mütterliche. Jedes konnte mit ihr sprechen, sie hatte
Zeit für jedes. Ihre Ratschläge kamen immer aus dem Herzen. Sie nahm
uns als Menschen, jeden nach seiner Eigenart und Veranlagung. Sie sprach selten
vor den andern etwas, das Bezug auf unser persönliches Leben und unsere
Zukunft hatte, aber trotzdem spürten wir ihre Anteilnahme und ihre Verbundenheit
mit uns. Sie hat manchem über eine schwere Krise hinweggeholfen einfach
dadurch, daß sie es in seiner Art zu verstehen suchte.“
Arbeitsauftrag:
- Fassen Sie die Vorstellungen Caselmanns von den Wesensformen des Lehrers, wie sie in diesem Textauszug sichtbar werden, zusammen, stellen Sie sie dem Plenum in geeigneter Form vor und beleuchten Sie sie kritisch.
- Finden Sie sich selbst oder andere Pädagogen, die Sie (vielleicht aus Ihrer Schulzeit oder Ihrem derzeitigen Kollegium) kennen, zutreffend in ihrer Wesensform durch Caselmann beschrieben?
- Typisierungen, wie die Caselmanns, lassen einen schnell an „Schubladen“ denken; doch obwohl Caselmanns Darlegungen schon recht lange zurückliegen, können wir doch noch heute bestimmte (moderner gewandete) Archetypen wiedererkennen. Haben „Schubladen“ doch etwas für sich?
5. Arno Combe: Kritik der Lehrerrolle
Der Schulmeister
Die intentionale Erziehung des Volkes und der „niederen Stände“ begann in den Handelsstädten des Mittelalters, wo ein dringendes Bedürfnis nach Kenntnissen in der Muttersprache, Lesen, Schreiben und Rechnen bestand. Die ersten Lehrer waren deshalb Lese-, Schreib- und Rechenmeister, die in den Hansestädten für die zahlungskräftige Kaufmannschaft zunächst auf privater Basis die Ausbildung ihrer Kinder in den Kulturtechniken übernahmen. Diese Lehrer rektrutierten sich aus Studenten, fahrenden Schülern oder gescheiterten und stellungslosen Theologen. Immer mehr nahm sich der städtische Rat des ‘niederen Schulwesens’ an, indem er entweder die Schulen selbst einrichtete und die Lehrer besoldete oder aber die privaten Lehrer konzessionierte und ihnen eine feste Stellung in der städtischen Verfassung zuwies. Unter solchen Bedingungen organisierte sich in Städten wie Lübeck, Frankfurt, Nürnberg, Augsburg und München um 1300 ein hauptberuflicher Lehrerstand, der sich nach dem Vorbild der Zünfte strukturierte.
Der Küsterlehrer
Mit der Reformation wird das Schulehalten zu einer Nebenfunktion des Dorfküsters, wie aus der Kursächsischen Kirchenordnung von 1580 oder aus Luthers Sermon „Daß man Kinder solle zur Schule halten“ zu entnehmen ist. Der Küsterlehrer wird hierbei ausdrücklich unter die geistliche Schulaufsicht des jeweiligen Dorfpfarrers gestellt. Diese Abhängigkeit ist vor allem beim Küsterlehrer verknüpft mit einer Anzahl ‘niedriger Kirchendienste’, vom Läuten bis zum Aufziehen und Stellen der Turmuhr, dem Reinigen der Kirche und dem Gesang bei Beerdigungen. Bungardt zählt 32 solcher Dienstleistungen auf. Der Lehrer war dabei finanziell völlig ungesichert und abhängig von den Schulgeldern der Eltern, die meist in Naturalien abgeliefert wurden.
Der Lehrerberuf als Sammelstätte für beruflich Gestrauchelte, Sekundärfunktion und Nebenverdienstquelle zahlreicher anderer Berufe
So fand etwa Friedrich II., daß ehemalige Soldaten und Unteroffiziere,
zum Felddienst untauglich und eines bürgerlichen Arbeitslebens ungewohnt,
für den Schulmeisterdienst gerade gut genug seien. Im preußischen
Generalschul-Reglement von 1763 forderte man vom Lehrer, daß er ein ‘nützliches’ Handwerk
als Haupttätigkeit ausübe, nicht zuletzt deshalb, daß sie ‘wissen,
wie sie ihre Zeit im Sommer, da auf dem Lande keine Schule gehalten wird,
zubringen’. Der Hauptgrund war aber, daß man sich vom kümmerlichen
Verdienst des Lehrers nicht ernähren konnte. Eine preußische Verordnung
von 1738 gesteht den Schullehrern das Schneidermonopol zu, um ihre wirtschaftliche
Lage zu verbessern. Noch 1806 befanden sich im Preußischen Lehrerseminar
109 Schneider, 21 Schuster, 5 Tischler usw.
Der Volksschullehrer gehörte also bis um 1800 mit Ausnahme der Lehrer
in den Städten ökonomisch wie geistig zum Proletariat, über
das sich selbst die niedrigsten Stände noch erhaben fühlten, wie
es das Spottlied vom „armen Dorfschulmeisterlein“ charakterisiert.
Verachtung, Rechtlosigkeit und Bevormundung von geistlicher und weltlicher
Obrigkeit waren weitere Kennzeichen des Standes. Motoren der gesellschaftlichen
Emanzipation des Lehrerstandes waren nun das Staatsbeamtentum, die permanente
Verbesserung der Ausbildung sowie die Volksbildungsidee in Preußen,
wo der Lehrer eine Art ‘Kulturmission’ zugewiesen bekam. Erst
im Jahre 1893 wurde das Schulamt in Preußen als ‘Hauptamt’ eingeführt,
was zwar einen kargen, aber dann doch regelmäßigen Lohn brachte.
Die entscheidende Verbesserung und Anhebung des Volksschullehrergehaltes
brachte aber erst die Zeit nach 1945. Übrigens in enger Wechselbeziehung
mit einer Anhebung des Ausbildungsstandards.
Einen wichtigen Mechanismus der sozialen Kontrolle stellt die eigene Erziehung
in einer bestimmten Herkunftsschicht dar. Diese führt bei ihm selber
zunächst dazu, daß er am Bestehenden nichts ändern will,
um die durch den Aufstieg erworbenen Privilegien nicht zu verlieren. Die
Lehrer tun zunächst das, was sie selber gelernt haben.
Die Lehrer haben eine aktivistische Wertorientierung verinnerlicht. Es wurde
an anderer Stelle gezeigt, wie sie die gesellschaftliche Ordnung als hierarchisch
ansehen. Nur die Beibehaltung einer klar nach Rängen geordneten Gesellschaft
bietet die Voraussetzungen, überhaupt aufsteigen zu können. Die
Vorstellungen, die sich mit dem Modell einer an Effizienzkriterien ausgerichteten
Gesellschaft verbinden, befestigen defensiv den Charakter der gegebenen Sozialordnung
gegenüber alternativen Modellen der gesellschaftlichen Produktion und
Distribution. Formen der Ungleichheit werden sanktioniert, wenn sie durch
individuelle Leistungen zustande kommen. Die Lehrer zeigen im Gefolge ihres
Leistungsdenkens ein starkes Abwehrverhalten nach unten: Man wehrt sich gegen
alle Nivellierungstendenzen, grenzt sich klar ab.
Der eigene soziale Aufstieg ist in der Regel mit einer peinlichen Einhaltung
der etablierten Regeln erkauft, mit einer ängstlichen Kopierung der
Normen der durch den Aufstieg erreichten Schicht: Konformität zahlt
sich aus. Das Konkurrenzverhalten, die individuelle Statuskonkurrenz, die
Rivalität innerhalb der eigenen Gruppe begrenzt allerdings die Fähigkeit
zu kollektivem politischen Verhalten.
Es gibt neben diesem ‘inneren Zwang’ zahlreiche äußere
Mittel, damit die Lehrer das tun, was von ihnen verlangt wird, wie man sie
auf ‘Vordermann’ bringen kann. Die Einhaltung der Erwartungen
durch den Lehrer von seiten einzelner gesellschaftlicher Gruppen wird dabei
durch ein soziales Kontrollsystem durchgesetzt. Dazu gehören etwa der
Entzug der gesellschaftlichen Anerkennung von seiten einer bestimmten Elternschaft,
die Notwendigkeit, sich im verwaltungsbürokratischen System an die Regeln
zu halten, wenn man Karriere machen will, z.B. die Möglichkeit der Schulverwaltung,
Druckmittel einzusetzen, die die berufliche und wirtschaftliche Existenz
bedrohen (Relegation, Kürzung des Gehaltes etc.). Die raffiniertesten
Kontrollmittel scheinen aber das Lächerlichmachen zu sein (Ironie, Spott,
Karikatur des Unzulänglichen), die soziale Ächtung (zum öffentlichen Ärgernis
degradieren), die teilweise „Stigmatisierung“ des Berufsstandes.
In einigen deutschen Untersuchungen ergibt sich ein ausgesprochen negativ
gefärbtes Stereotyp des Lehrers: „Der Lehrer wird vielfach im
Film als Karikatur des Unzulänglichen, hart und ohne Gefühl für
seine Zöglinge und nur in einzelnen Exemplaren menschlich dargestellt.“ Dieses
Stereotyp findet sich auch in der Literatur: auf der einen Seite Anklage,
Abneigung, ja Ausfälle gegen die Schule, auf der anderen Seite Spott,
Ironie und Verniedlichung. Die Schule und der Lehrer werden vielfach zum öffentlichen Ärgernis
degradiert.
Arbeitsauftrag:
- Fassen Sie Combes historisch – soziologische Deutung der Lehrerrolle mit den aus ihr resultierenden Folgerungen zusammen, stellen Sie sie dem Plenum in geeigneter Form vor und beleuchten Sie sie kritisch.
- Combe zielt mit seinen Ausführungen auf die Lehrerschaft gegen Ende der 60-er, Anfang der 70 er Jahre. Was hat sich Ihrer Meinung nach angesichts des 3. Jahrtausends geändert ?
- Sehen Sie bei den heutigen Lehrern soziologisch bedingte „Krankheitssymptome“ ? Welcher Art sind sie ?
6. Otto Friedrich Bollnow: Über die Tugend des Erziehers
Über die Tugenden des Erziehers zu sprechen ist heute ein gewagtes
Unternehmen. Man setzt sich dabei dem Verdacht aus, vor einer nüchternen
wissenschaftlichen Behandlung des Erziehungsvorgangs in eine billige
moralisierende Betrachtungsweise zurückzuweichen, die wir durch
die Ausbildung einer empirischen Erziehungswissenschaft endlich überwunden
zu haben glaubten. Schon das bloße Wort „Tugend“ ist
heute nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch im alltäglichen
Sprachgebrauch verdächtig geworden. Es klingt nach einer ängstlichen
Anpassung an die Forderungen der herrschenden Moral, nach der Haltung
eines bloßen Musterschülers; der sich nicht aufzulehnen wagt
und sich widerspruchlos allen Anforderungen seiner Umwelt fügt.
Tugendhaftigkeit scheint mehr in einem Verzicht als in der Äußerung
eines kraftvoll sich entfaltenden Lebens zu liegen. War noch vor 100
Jahren die Tugendhaftigkeit die Auszeichnung eines wohlgeratenen jungen
Menschen, so wird sich die heutige Jugend nicht gerne als tugendhaft
bezeichnen lassen. Von einem tugendhaften Lehrer oder Erzieher zu sprechen
ist heute nahezu unmöglich. Es würde gleich die Vorstellung
von Untertanengeist und mangelnder Zuvilcourage erwecken.
Und dennoch darf man bei aller wissenschaftlichen Behandlung des Erziehungs-
und Unterrichtsvorgangs nicht vergessen, dass es letztendlich der Mensch
ist, die in ihrer vollen Menschlichkeit überzeugende Persönlichkeit,
die im Kind erst die Erziehungsbereitschaft hervorruft und ohne die alle
Erziehungsbemühungen wirkungslos bliebe …
Ich möchte nun drei Tugenden herausgreifen, die mir beim Erzieher
für das Gelingen seiner Bemühungen besonders wichtig zu sein
scheinen: die erzieherische Liebe, die Geduld und das Vertrauen.
I.
Die erste erzieherische Tugend ist die Liebe. Sie allein gibt dem auf
die Veränderung der seelischen Struktur des zu Erziehenden gerichteten
Tun einen warmen menschlichen Ton und macht überhaupt erst den
Eingriff in die Persönlichkeit des Kindes, so sehr dieser sachlich
berechtigt und gefordert sein mag, für das Kind erträglich.
Aber mit dem Wort Liebe ist zu wenig gesagt. Es ist eine Liebe besonderer
Art, die wir in ihrer Besonderheit erfassen müssen.
a.) Man hat seit alters her gern von einem pädagogischen
Eros gesprochen und damit auf die tiefsinnige Liebe Platons verwiesen:
die Liebe zur schönen Seele im schönen Leib des Knaben, die
sich dann zur Liebe zum Schönen überhaupt erhebt. Und sicher
ist damit, wenn wir von der Besonderheit der griechischen Knabenliebe
absehen, etwas Wesentliches getroffen: der eigentümlich ästhetische,
frohgemute, ich möchte sagen: frühlingshafte Zug in der erzieherischen
Zuwendung. Wir freuen uns an dieser Freude des Erziehers an seinem Tun.
Viele sind erst dadurch zu Erziehern geworden.
Trotzdem liegt in dieser Erotisierung der Erziehung, auch wenn sie noch
so vergeistigt verstanden wird, eine Gefahr. Auf jeden Fall trifft sie
nicht den Kern des erzieherischen Verhältnisses, und es ist wichtig,
sich den Unterschied klar zu machen. Max Scheler hat
in seinem Buch „Wesen und Form der Sympathie“ in überzeugender
Weise herausgearbeitet, wie die Liebe nicht etwa blind macht, wie eine
verbreitete Redensart sagt, sondern im Gegenteil die Augen öffnet
für die in einem Menschen vorhandene Wertqualitäten. Die Liebe
ist bewundernd, aufschauend, nicht umsonst spricht man in der Umgangssprache
von einer Angebeteten und einem Anbeter. Auf jeden Fall: der Liebende
liebt den Menschen so, wie er ist, in der ihm erscheinenden Vollkommenheit.
Er kann gar nicht auf den Gedanken kommen, an dem geliebten andern
Menschen etwas verändern zu wollen. Zusammengefasst. die erotisch
verstandene Liebe schließt die Absicht, etwas verändern zu
wollen, und damit die pädagogische Absicht aus, und wo sie auftritt,
wird sie vom Geliebten als Verrat empfunden. Das gilt auch vom Verhalten
zum Kind. Die ästhetisch geprägte Liebe freut sich an der Vollkommenheit
des Kindes, und zwar gerade so, wie es jetzt ist, in diesem Stadium seiner
Entwicklung. Sie kann höchstens nur mit Wehmut daran denken, wie
bald die Entwicklung darüber hinausgeht und die jetzige Schönheit
wieder zerstört. Sie fragt vielleicht in tiefer Resignation, warum
aus so glücklichen, schönen Kindern so abscheuliche Erwachsene
werden.
Noch einmal: die erotische Liebe nimmt den Menschen so, wie er ist. Fehler
an ihm erkennen zu müssen, ist schmerzlich, und solche Fehler verbessern
zu wollen, also erziehen zu wollen, ist Versündigung am Geist der
Liebe. Ein Erziehungsversuch zerstört die Liebe, der er doch in
guter Absicht dienen wollte, und diese Wirkung ist oft nicht wieder rückgängig
zu machen. Das ist vielleicht eine der schmerzhaftesten Erfahrungen,
die der liebende Mensch machen kann.
b.) Aber nicht alle Liebe ist Eros. Es gibt noch eine ganz andere Liebe, nämlich die sich hinabneigende Liebe zum notleidenden und geschundenen andern Menschen, die in Ehrfurcht vor dem Leiden hinabsehende Liebe, die aus dem Mitleid und sich im Willen zur Hilfe zur Linderung der Not auswirkt. Während die erste Form dem antiken Kulturkreis entsprungen ist, gehört die zweite der christlichen Überlieferung an. Es ist die agape, die caritas. Auch sie hat sich als wesentlicher Faktor in der Erziehung ausgewirkt, als besondere Hinwendung zu den Armen und Unterdrückten, zu den geistig und körperlich Behinderten. Pestalozzi mag mit seiner Armenerziehung als großes Beispiel dastehen. Mönchsorden und Kongregationen haben schon im Mittelalter Bewunderswertes geschaffen, und in der heutigen Sozialpädagogik ist sie wieder lebendig. Man könnte mit einigem Recht den unter deprimierenden Bedingungen arbeitenden Sonderschullehrer als Heiligen unserer Tage bezeichnen. Der Pädagoge fühlt sich in innerster Seele den vom Leben Benachteiligten verbunden und empfindet in sich Streben, die Ungerechtigkeit ihres Schicksals, soweit es in seinen Kräften steht, auszugleichen.
c.) Und trotzdem ist die aus der caritas entsprungene
Hilfe noch kein eigentlich erzieherisches Verhalten. Sie will dem anderen
Menschen in seiner Not beistehen, indem sie seine Umstände verändert. Ihn
selbst aber will sie nicht verändern (oder höchstens so weit,
dass er imstande ist, sich mit seinen widrigen Umständen besser
abzufinden). Erziehung aber will den Menschen verändern. Wenn man
auch die Erziehung eigentlich nicht ganz unverständlich als Lebenshilfe
bezeichnet hat, so ist das doch eine Hilfe ganz besonderer Art, nämlich
eine solche, die nie die Umstände, sondern den Menschen selbst betrifft.
Die erzieherische Hilfe will, ganz banal ausgedrückt, dem
Kind oder allgemein ausgedrückt, dem anderen Menschen helfen, eine
neue Stufe seiner Entwicklung zu erreichen. Insofern ist auch die richtig
verstandene Psychotherapie nicht nur Herstellung, d.h. Wiederherstellung
eines durch Krankheit verloren gegangenen gesunden Zustandes, sondern
zugleich Erziehung, d.h. Hilfe bei der Erreichung eines neuen Reifezustandes.
Es wäre wohl an der Zeit das Verhältnis von Pädagogik
und Psychotherapie einmal grundsätzlich zu durchdenken. Im Sinne
der Rechtfertigung auf die zu erreichenden Stufen hat Spranger
immer wieder die erzieherische Haltung beschrieben. Der Erzieher sieht
im Kind die in ihm angelegten Wertmöglichkeiten nicht, wie bei Scheler,
die schon vorhandenen Werte, sondern die noch schlummernden Wertmöglichkeiten,
und diesen will er durch sein Tun zur Entfaltung helfen.
Und trotzdem ist diese Bestimmung ein wenig zu schön. Sie übersieht
die leidvollen Erfahrungen, die jeder Erzieher macht: dass es im Kinde
nicht nur die idealen Möglichkeiten gibt, die es zu entfalten gilt,
sondern auch die Bosheit und die Schwäche, die die Entwicklung behindern
und verkehren. Der Erzieher – und mit ihm die pädagogische
Theorie – darf hierfür nicht blind sein. Er muss mit seiner
Liebe und seinem Blick für die schlummernden idealen Möglichkeiten
zugleich das Kind ganz realistisch sehen: mit all seinen Schwächen
und Gebrechen, die all seine Erziehung immer wieder in Frage stellen.
Mein verehrter Lehrer Herman Nohl hat immer
wieder betont, dass erst die Verbindung von idealistischem und
realistischem Blick das Wesen des erzieherischen Verhältnisses ausmacht.
Und diese Doppelheit bestimmt auch das Wesen der erzieherischen Liebe,
in der mehr Komponenten vereinigt sind: die naive Liebe zum Kind, besonders
zum kleinen Kind in seiner rührenden Hilflosigkeit, die eine aufbauende
Arbeit anregende Liebe zu dem im Kind schlummernde Möglichkeiten
und die teilnehmende geduldige Liebe ( ich will nicht sagen zu seinen
Schwächen, aber) in all seinen Schwächen.
Aber pädagogisch ist sie nur, wenn sie kein weichliches Nachgeben
gegenüber den leider nun einmal vorhandenen Schwächen ist,
sondern bei aller Nachsicht den erzieherischen Anspruch unbeirrt aufrecht
erhält, wenn sie in aller Milde zugleich streng ist und nur in dieser
Strenge das Kind wirklich ernst nimmt. Sie bewegt sich also in der schwer
zu gewinnenden Mitte zwischen verständnisvoller Nachsicht und sittlicher
Forderung. Weil diese Mitte aber schwer einzuhalten ist, weil sie vom
Erzieher die Zurückhaltung seines unmittelbaren Formungswillens
fordert, darum ist diese Liebe nicht einfach Naturanlage eines „geborenen
Erziehers“, sondern wie Spranger es in eindringlicher Warnung vor
diesem irreführenden Begriff hervorgehoben hat, eine Tugend, die
erst in strenger Selbsterziehung in immer neu geübter Geduld und
Zurückhaltung erworben werden muss. „Der Erzieher“,
sagt Spranger: „wird geboren aus Selbsterziehung“.
2.
Damit sind wir unversehens zu der zweiten großen Erziehertugend
gekommen, der Geduld. Zwar ist die Geduld eine allgemein von Menschen
geforderte Tugend und nicht auf den Erzieher beschränkt, aber sie
betrifft den Erzieher in einer ganz besonderen Weise. Aber ehe wir auf
das besondere Problem der vom Erzieher geforderten Geduld eingehen, ist
es zweckmäßig, einige allgemeine Erwägungen über
das Wesen der geduld vorauszuschicken und etwas nachholen, was ich in
früheren Arbeiten nicht voll genug gesagt habe. Die Geduld betrifft
auf der einen Seite das Verhältnis des Menschen zur Zeit. Sie ist
die Kunst des Abwarten-Könnens. Sie ist darum so schwer zu erlernen,
weil der Mensch die natürliche Neigung hat, den Ereignissen, insbesondere
den erfreulichen, in Gedanken vorauszueilen, ihr eintreten nicht abwarten
zu können. Er verzehrt sich dann in seiner Ungeduld und Vernachlässigt
die Forderungen des Augenblicks. Die Geduld ist demgegenüber die
Fähigkeit des Warten-Könnens, bis der richtige Zeitpunkt gekommen
ist, als die Fähigkeit, die natürliche Ungeduld zu beherrschen.
Darin kommt der eigentliche Tugend-Charakter zum Ausdruck: Im Unterschied
zu anderen, sich von innen heraus entwickelnden, sozusagen natürlichen
Tugenden wie Mut, Tapferkeit usw. muss die Geduld erst durch Selbstdisziplin
der natürlichen Neigung abgewonnen werden.
Darin kommt zugleich die andere Seite der Geduld zum Ausdruck. Geduld hängt sprachlich mit dulden zusammen (wenn das Wort auch nicht aus dem Verbum abgeleitet ist, sondern das Verbum erst aus dem Substantiv Geduld). Man spricht von einem in Geduld ertragenden Leiden , Geduld bezeichnet das freiwillige Hinnehmen von Widerwärtigkeiten, das Erleiden also das Sicheinfügen in das Unvermeidbare mit all seiner Bitterkeit. Es ist eine Tugend der Passivität. Aber auch diese Seite der Geduld fasst sich unter einem bestimmten zeitlichen Aspekt. Geduldig ist noch nicht das Hinnehmen eines Schicksalsschlags, einer Niederlage oder eines schweren Verlusts, sondern geduldig ist der Mensch erst in der Dauerbelastung, etwa eine lang währende Krankheit. Den Schicksalsschlag nimmt man hin und setzt sich mit ihm ehrlich auseinander, und damit ist die Angelegenheit abgetan. Geduld aber übt man bei einer lang andauernden Belastung. Sie ist so schwer zu erlernen, weil man sie immer neu aufbringen muss.
Vor diesem doppelten Hintergrund muss man aber auch die Geduld des Erziehers sehen. Sie ist auf der einen Seite die Kunst des Wartens-Könnens und in sofern die Geduld des Gärtners oder des Landmannes, die das Wachstum von sich aus nicht beschleunigen können, sonder warten müssen, bis die Ernte reif geworden ist. Das gilt auch für den Erzieher, soweit man sein Geschäft als ein Wachsen-lassen betrachten kann. Aber gerade weil der Erzieher die schlummernden Möglichkeiten im Kinde sieht, hat er das natürliche Verlangen, sie auch verwirklicht zu sehen und die Entwicklung so schnell wie möglich voranzutreiben. Die Mutter freut sich über alles, was ihr Kind „schon kann“, und ist geneigt, in ihrer Freude darin gleich ein Wunderkind zu sehen. Der Lehrer freut sich an den Lernfortschritten seiner Klasse und wird ungeduldig, wenn sich einige Nachzügler melden, die etwas immer noch nicht verstanden haben. Daher die Tendenz zur Verfrühung als die spezifische Gefahr der Pädagogik. Und demgegenüber bedeutet die Geduld die Disziplinierung des natürlichen Strebens, der Zeit vorauseilen zu wollen, das richtige Sich-einfügen in den natürlichen Lauf der Zeit. (Wenn ich also von einem Sich-einfügen spreche, so ist damit zugleich gesagt, dass man nicht nur vorauseilen, sondern auch nicht hinter dem, „was in der Zeit ist“, aus schuld oder Schwäche zurückbleiben darf. Geduld ist also alles andere als bloße Nachlässigkeit).
Aber wenn man sagt, dass der Erzieher mit seinen Kindern Geduld haben muss, so hat das noch einen anderen Sinn- Er muss Geduld haben mit ihren Schwächen, Geduld mit ihren Unarten und Bosheiten, geduld vor allem, wenn sie immer wieder rückfällig werden, auch wenn sie mit ehrlichem Herzen Besserung versprochen haben. Geduld fordert das Vorgehen können und die Kraft zu einem neuen Anfang. Und wenn man im Evangelium auf die Frage, ob es genüge, sieben mal zu vergeben, die Antwort gegeben wird: nein, sondern sieben mal siebzig- mal, ist damit die schwere Aufgabe des Erziehers bezeichnet : immer wieder verzeihen und verstehen müssen, um nach allen Enttäuschungen mit neuem Vertrauen wieder anfangen zu können. Das geht oft an die Grenzen des Menschenmöglichen, und das kann der Erzieher nur leisten, wenn er über alle Rückschläge hinaus das feste Vertrauen hat, dass auf die Dauer seine geduldige Arbeit nicht vergebens ist.
3.
Damit sind wir bei der dritten Grundtugend des Erziehers: dem Vertrauen.
Es ist heute allgemein bekannt, wie wichtig es für ein Kind und
besonders für ein kleines Kind ist, dass es in einer Welt aufwächst,
in der es sich geborgen fühlt, insbesondere dass es sich mit einem
bestimmten anderen Menschen verbunden fühlt, der ihm diese Geborgenheit
vermittelt, weil es zu ihm ein uneingeschränktes Vertrauen hat.
In der Regel ist es im ersten Lebensjahr bekanntlich die Mutter. Ich
kann mich nicht enthalten, hier das Wort des mir befreundeten, allzu
früh verstorbenen Kinderarztes Alfred Nitschke anzuführen. „Die
Mutter“ so schreibt er in seinem schönen Buch über
den Menschen als „das verwaiste Kind der Natur“, auf das
ich noch einmal nachdrücklich hinweisen möchte. „Die
Mutter schafft mit ihrer sorgenden Liebe für das Kind den Raum
des Vertrauenswürdigen, Verlässlichen, Klaren. Was in ihm
einbezogen ist, wird zugehörig, sinnvoll, lebendig, vertraut,
nahe und zugänglich. Daher stammen die Kräfte der Einsicht,
die dem Kind den Zugang zur Welt, zu den Menschen und zu den Dingen
ermöglichen“. Also: auch das Verständnis der Welt im
Ganzen wird dem Kind erst durch den Bezug zu einem bestimmten einzelnen
Menschen vermittelt. Daher ist der ungeheure Schaden, der entsteht,
wenn ein solcher vertrauenswürdiger Mensch nicht vorhanden ist.
Das ist heute bekannt und durch die Untersuchungen von Spitz vielfach
bestätigt.
Sehr viel weniger wird die Wichtigkeit des in entgegen gesetzter Richtung verlaufenden Vertrauens beachtet, des von seiner Umgebung, insbesondere seinem Erzieher, dem Kind entgegengebrachte Vertrauens, des Vertrauens also, das nicht das Kind seiner Umgebung entgegenbringt, sondern das ihm von seiner Umgebung entgegengebracht wird. Und trotzdem gilt auch hier, dass das Kind ohne ein solches ihm von der Umgebung entgegengebrachten Vertrauens sich nicht richtig entwickeln kann und darum durch den Entzug dieses Vertrauens in seiner Entwicklung schwer geschädigt wird.
Das wird vielleicht am durchsichtigsten im Falle des Versprechens. Ich kann einem anderen Menschen nur etwas versprechen, wenn dieser andere Mensch auch bereit ist, mein Versprechen anzunehmen, und das heißt, dass dieser auch davon überzeugt ist, dass ich meine Versprechen halten kann und halten werde. Verweigert er die Annahme des Versprechens, erklärt er etwa skeptisch oder spöttisch überlegen, dass ich es doch nicht halten werde, weil es mir dazu an Kraft oder gutem Wille fehlt, so entzieht er mir dadurch die Kraft, dies Versprechen zu halten, und bringt gerade das hervor, was er befürchtet hatte. Es gibt keine Treue in den leeren Raum. (Dagegen darf man nicht einwenden, dass es auch Versprechen gibt, die man sich selbst gibt. Das ist ein sehr nachlässiger Sprachgebrauch. Sich selbst gegebene versprechen gibt es nicht. Das sind höchstens gute Vorsätze. Und das ist etwas ganz anderes. Versprechen kann man nur einem anderen geben. Sie bleiben immer vom Vertrauen anderer abhängig. Das ist für die Erziehung von allergrößter Bedeutung. Nur wo ich dem Kind etwas zutraue, traut es auch sich selbst etwas zu ….)
Das kann man noch etwas allgemeiner fassen: Das Kind formt sich unbewusst nach dem Bild, dass sich der Erzieher von ihm macht. Es wird wirklich so, wie der Erzieher es von ihm erwartet. Wenn es der Erzieher für ehrlich, ordentlich, fleißig, zuverlässig usw. hält, dann werden eben dadurch die entsprechenden Eigenschaften beim Kinde geweckt. Und umgekehrt, wo der Erzieher im Kinde nur immer das Schlechte argwöhnt, da wird das schlechte durch den Argwohn geradezu hervorgerufen, und das Kind wird wirklich so dumm und faul und verlogen, wie es der Erzieher von ihm erwartet hatte. Das belastet den Erzieher mit einer ungeheuren Verantwortung, denn sein Urteil über das Kind ist nicht seine Privatangelegenheit, sondern wirkt sich unmittelbar auf die kindliche Entwicklung aus …
Das ist für die Erziehung von ungeheurer Bedeutung: Nur wo der Erzieher wirklich an ein Kind glaubt, wo er Vertrauen zu ihm hat, kann sich das Kind entwickeln. Die Frage aber ist: Woher nimmt der Erzieher die Kraft zu diesem Vertrauen? Denn die Wirkung dieses Vertrauens geschieht nicht in der Art eines zwangsläufigen Naturgesetzes. Sie kann auch ausbleiben, und sie bleibt auch häufig aus. Immer wieder wird der Erzieher enttäuscht. Immer wieder bleibt das Kind hinter den Erwartungen zurück. Immer wieder stößt der Erzieher auf Schwäche und Bosheit. Immer wieder scheitert er bei seinen gut gemeinten versuchen. Das Scheitern gehört wohl wie in keinem anderen Beruf zur Arbeit des Erziehers. Es wäre Feigheit, das nicht sehen zu wollen. Und hier setzt die eigentümliche Schwierigkeit des Erziehers ein: trotz aller bitteren Enttäuschungen, trotz aller so genannten Erfahrungen das Vertrauen wieder aufbringen zu müssen …
Das gelingt ihm nicht aus eigener Kraft auf bloßen Vorsatz hin. Das ist nur möglich, wenn sich der Erzieher seinerseits von einem anderen und tiefen Vertrauen getragen ist, von einem Vertrauen darauf, dass trotz aller Rückschläge und Misserfolge sein Tun einen Sinn hat. ….
nach oben7. Eduard Spranger: Der geborene Erzieher
Gegen die Fassung des Titels dieser Schrift können Bedenken erhoben
werden; sie sind im Text berücksichtigt.
Ich glaube, im deutschen Schulleben unserer Tage gewisse Klimaveränderungen
zu bemerken , die nach der Seite der Trockenheit hingehen. Aus der Sorge
heraus, daß die Austrocknung zu groß werden könnte ,
habe ich vor zwei Jahren das kleine Heft „Der Eigengeist
der Volksschule“ veröffentlicht. Hier folgt eine zweite Herzensergießung.
Sollte es trotz meines hohen Alters noch so weiter gehen, käme vielleicht
eine Schriftenreihe zustande, der ich die Sammelbezeichnung geben würde: „Mehr
Freude an der Schule!“
Die vorliegende Schrift ist aus einem Vortrag entstanden, den ich im
Frühjahr 1956 bei der Entlassungsfeier der Studenten des Pädagogischen
Instituts in Weingarten gehalten habe.
Hier soll nur von einem Beruf die Rede sein, der völlig seinen Sinn verliert, wenn er nicht mit der „Leidenschaft des Geistes“ ergriffen wird, nämlich von dem des Erziehers, in den der des Lehrers wesensmäßig miteingeschlossen ist.
Wenn man heute vom „Wehen des Geistes“ redet, gerät man in den Verdacht, aus einer versunkenen Zeit zu stammen, in der man noch mit Pathos etwas ausrichten konnte. Man muß sich daher auf Fälle zurückziehen, in denen es wirklich ohne „Inspiration“ nicht geht. Bei dem schöpferischen Künstler redet man ausdrücklich vom „Genie“. Man bedient sich dann nur des lateinischen Wortes genius für das Besessensein von einem Daimon. Jeder denkt dabei sogleich an das Daimonion, dessen Stimme Sokrates in sich zu hören behauptet hat. Was er damit eigentlich gemeint hat, ist immer noch strittig. Es gibt wirklich sehr verschiedene Geister, die durch Menschen hindurch wirken können. Auch dies wäre ein interessantes Unternehmen, zu studieren, welche Dämonen in unserer Zeit der „Entmythologisierung“ etwa übrig geblieben sind. Später wird sich herausstellen, daß der „Geist der Erziehung“ von dem des künstlerischen Schaffens grundsätzlich verschieden ist. Kein Zweifel aber, daß es auch so etwas gibt, wie pädagogische Genialität.
Es gibt keinen Beruf, zu dem man weniger „geboren“ sein könnte, als den des Erziehers. Denn zu seinem Wesen gehört eine beträchtliche Reife. Wenn es aber eine Art von innerem Vorgeformtsein auch für geistige Leistungen gibt, zu deren Entfaltung ein langer Bildungsweg nötig ist, so kann man wohl in einem übertragenen Sinne vom „geborenen Erzieher“ sprechen. Die Bezeichnung ist dann ein Ausweichen vor dem Fremdwort „der .......... Erzieher“, meint aber das Gleiche, nämlich den Pädagogen von so echter Art, „als ob“ er für das Erziehertum geradezu geboren wäre. Wir sagen ja auch: „der geborene Feldherr“, und doch kann niemand zum Feldherrn, geschweige dann „als Feldherr“ im wörtlichen Sinne geboren werden.
Im Grunde zielt dieses Bemühen auf immer neue Umschmelzungen des
Inneren. Man denke an den Knopfgießer in Ibsens „Peer Gynt“!
Wo geschmolzen werden soll, ist ein Feuer nötig. Ohne Bild: nur
in der Temperatur der Liebe gelingt es, Menschen in ihrem Kern zu beeinflussen.
Ihre Wärme durchwaltet das ganze Gemüt und strahlt aus auf
die Begegnung von Erzieher und Zögling. Das haben wir oft gelesen,
besonders bei Pestalozzi; ebenso bei Kerschensteiner. Aber man glaube
nicht, daß mit diesem Zauberwort das letzte Rätsel gelöst
sei. Vielmehr fängt nun das Gebiet erst an, auf dem der geborene
Erzieher seine Kraft entfalten muß.
Liebe ist ein vieldeutiges Wort. Es gilt, diejenige Art ins Spiel zu
setzen, die dem Geist der Erziehung gemäß ist. Es kommt auch
darauf an, ihre Temperatur richtig zu temperieren. Darüber gibt
es kein Vorschriftenbuch.Vielmehr ist es eben der geborene Erzieher,
der hier aus einem tiefen geistigen Instinkt heraus das Richtige trifft.
Die anderen mögen ihm zusehen und ihm ein wenig von dieser Kunst
ablernen. In Autobiographien finden wir Gestalten von Müttern, die
schon die Natur mit einer wunderbaren Liebesfülle ausgestattet hat.
Noch lehrreicher aber sind wohl die Bilder von Vätern, deren ernste
Lebensführung von einer verhaltenen Liebe durchdrungen ist. Sie
läßt sich immer finden, wenn es not tut. Aber sie strömt
nicht einfach; sie stellt ihre Bedingungen, und erst deshalb ist sie
für den Bildsamen eine bildende Liebe.
Bei der didaktischen Bearbeitung des Objektes muß aber auch der Entwicklungsstufe des Subjektes, nämlich des zu Bildenden, Rechnung getragen werden. Jedes Lebensalter hat seine eigentümliche Seelenstruktur. Von ihr her bestimmt sich die Aneigungsfähigkeit und Aneignungsweise. Dem geborenen Erzieher verwandelt sich sein Bildungsgut, obwohl es seinerseits eindeutige Forderungen an den Aufnehmenden stellt, unter der Hand doch ganz von selbst, je nachdem ob es sich an das magische Alter oder an das folgende, für das wir keinen übergeschlechtlichen Namen haben, oder an das Reifungsalter wendet. Ein und dieselbe Geschichte z.B. muß da ganz verschieden erzählt werden.
Es wäre für den Anfänger lehrreich, solche „didaktischen
Variationen“ über ein Thema einmal fixiert vor Augen zu haben.
Allgemein gilt: Der geborene Lehrer und Erzieher ist unablässig
darauf bedacht, die verwirrende Fülle geistig geformter Weltgehalte
auf einfache und der jeweiligen seelischen Entwicklungsstufe des Werdenden
zugängliche Modelle zurückzuführen.
Es kommt also nicht einfach darauf an, daß eine Gemeinschaft da ist, in der und für die erzogen wird, sondern es kommt auf die sittlichen Gehalte an, zu denen sich die Gemeinschaft gleichsam wie das tragende Gefäß verhält. Deshalb kann diese Art der formenden Einwirkung auch niemals sich selbst überlassen bleiben, wie etwas, das sicher und gut „funktioniert“. Es muß immer eine Persönlichkeit da sein, die die Wirkungen auswählt und lenkt. Der Gruppengeist bedarf der Kontrolle und der ständigen Reinigung durch das Gewissen. Ein Gewissen aber hat immer nur der Einzelne. Entscheidend ist, solange es noch der Hilfe und Führung bedarf , d a s G e w i s s e n d e s E r z i e h e r s .
Der echte Erzieher stellt derartige philosophische Reflexionen kaum
an. Er besitzt ein ursprüngliches Organ für die Bahnen, in
denen der durch ihn hindurchwirkende Geist weht. Dieser Geist hat in
Gemeinschaften, zu denen wesensmäßig „das Erzieherische“ gehört,
wie etwa inFamilie und Schule, seine eigentliche Heimat. In andere wird
der geborene Pädagoge ihn hineintragen; ja er wird immer den Drang
empfinden, eine Jüngerschaft um sich zu versammeln, gleichsam eine
Sekte im Dienst der Menschenveredlung.
Es ist kein Geheimnis, daß sich diese schöne Hoffnung nicht
immer erfüllt. Ein Gebäude mit Klassenzimmern, ein staatlich
oder anderswie beauftragter Leiter, eine Schulordnung und ein Stundenplan
gewährleisten noch nicht, daß sich in diesem Rahmen der eigentliche
Geist der Erziehung verwirklicht. Dazu gehört ein Schwung besonderer
Art, der auch für ein hohes Gehalt nicht ohne weiteres zu haben
ist. Worauf es beruht, daß in einem solcher Häuser Funken
heiligen Feuers sprühen, in einem anderen aber nur eine kümmerliche
Flamme schwelt, ist vielleicht gar nicht auszusprechen. Genug: man merkt
es schon beim Hineintreten.
Die passive Müdigkeit, die so leicht in einer Klasse Platz greift,
kann nur dadurch überwunden werden, daß alle mit allen ins
Gespräch kommen und sich um etwas bemühen, das ihnen interessant
ist. Interesse heißt „Dabei-sein“. Was getrieben wird,
geht jeden an. Der Lehrer hört dadurch, daß er die Individualitäten
eine Zeitlang frei walten läßt, nicht auf, Autorität
zu sein. Er vermag die allgemeine Fröhlichkeit sofort wieder in
Ernst zu verwandeln, wenn genug gelacht worden ist. Vor allem: seine
Sache verbreitet deshalb immer eine wohltuende Temperatur weil sie immer
darauf angelegt ist, daß man innerlich an ihr wächst. Wo dieses
Gefühl durchbricht, ist ein guter Resonanzboden da. Wo es noch nicht
erzielt werden konnte, behält der bestgemeinte Bildungsprozeß etwas
von Abrichtung.
Es mag viel verlangt sein - aber wir träumen ja hier von einem
Ideal: Gerade das Selbstverständliche, Unmerkliche seines Tuns macht
den vollendeten Erzieher aus, und das pädagogisch gemeinte Zusammenleben
ist eben ein Miteinander von reifen und heranwachsenden Menschen, bei
dem Wertvolles geleistet wird, jedoch ohne den lauten Ausruf:“Hier
wird erzogen“.Das sollte die Regel sein. Natürlich gibt es „Ausnahmezustände“,
bei denen die stille Intention deutlicher hervortritt.
Falls jemand an dieser Stelle um nähere Auskunft bäte, wie
denn ein so schönes Ziel zu erreichen sei, so kann man ihn leider
nicht auf einen bestimmten Paragraphen eines Lehrbuches der Erziehungswissenschaft
verweisen. Aber unsere von vornherein als mißverstehbar bezeichnete
Redeweise vom „geborenen Erzieher“ kann doch durch weitere
Aufhellung der Zusammenhänge verbessert werden.Zum Erzieher gehören
eben Eigenschaften, die nicht auf Einsicht beruhen und daher weder lehrbar
noch lernbar sind. Vor allem bedarf er der ständigen Selbstdisziplin.
Man kann die Behauptung wagen:der wahre Erzieher lebt von dem Maß der
Selbsterziehung, das er an sich geleistet hat. Das Kapital von
Energie und Methodik, das dabei angesammelt worden ist, setzt sich täglich
in die kleine Münze des Einflusses auf andere um. Das Schönste
dabei ist, daß es nie erschöpft werden kann, es sei denn bei
völliger Erschöpfung der eigenen physischen Kräfte, die
allerdings bei einer so anstrengenden Tätigkeit wie der des Pädagogen
eine immer nahe Gefahr bedeutet.
Schon das Geheimnis des Disziplinhaltens klärt sich von diesem Zusammenhang
her auf . Mancher besitzt diese Gabe vom ersten Augenblick an. Wer sie
nicht hat, mag sonst ein sehr ehrenwerter Mann sein; aber zum rechten
Erzieher fehlt ihm Wesentliches. Das Ordnungshalten kann man auch nicht „lernen“.
Man muß vielmehr sein eigenes Inneres sorgfältig revidieren,
ob in ihm die Verhältnisse von Willensmacht und Unterordnung richtig
verteilt sind. Mit der sicheren Herrschaft über sich selbst fängt
alles Regieren von Menschen an. Äußere Zwangsmittel helfen
wenig. Innere Qualitäten sind entscheidend. Man muß freilich
hinzufügen es sind besondere Eigenschaften, die der Jugend je auf
ihren verschiedenen Stufen imponieren. Wer gerade über sie nicht
verfügt, mag im Rate der Weisen viel gelten: unser "geborener
Erzieher“ ist er nicht.
Arbeitsauftrag:
- Fassen Sie die Vorstellungen Sprangers vom Wesen des „geborenen Erziehers“ zusammen, stellen Sie sie dem Plenum in geeigneter Form vor und beleuchten Sie sie kritisch.
- Auch wenn Sprangers Titel vom „geborenen Erzieher“, seinen eigenen Hinweisen gemäß, nicht ganz wörtlich zu nehmen ist, so sind doch genügend Hinweise auf ein wörtliches Begriffsverständnis vorhanden, z.B. wenn Spranger von Eigenschaften spricht „die nicht auf Einsicht beruhen und daher weder lehrbar noch lernbar sind.“ Reflektieren Sie dieses Begriffsverständnis auf dem Hintergrund Ihrer Ausbildung.
- Wenn Sie Ihre Kolleg(inn)en und sich selbst mit dem von Spranger gezeichneten Bild des „geborenen Erziehers“ vergleichen, wie fällt dieser dann aus ? Ergeben sich für Sie daraus Konsequenzen für Ihre künftige Berufsausübung ?
8. Bauer, Kopka &. Brindt:
Pädagogische Professionalität und Lehrerarbeit
Der Begriff der pädagogischen Professionalität
Ein Ziel unserer Forschungsarbeit ist es, den Begriff der "pädagogischen Professionalität" zu klären und auszuschärfen. In einer früheren Arbeit (Bauer/ Burkard 1992) haben wir drei Ansätze der Professionalisierungsforschung unterschieden:
- den kriterienbezogenen Ansatz (z.B. Schwänke 1988)
- den historischen Ansatz (Burrage/Torstendahl 1990, Tenorth 1987)
- den auf pädagogische Arbeitsaufgaben bezogenen Ansatz (Devaney/Sykes 1988, Lieberman 1990)
Kriterienbezogener Ansatz
Zum Kernbereich von Professionalität gehören die Kriterien
Autonomie, Berufsethos, Reflexivität, Kooperation und wissenschaftliche
Basis der Berufsausübung (Berufswissenschaft) sowie eine besondere
Berufssprache.
Der kriterienbezogene Ansatz orientiert sich am Muster bestimmter, vollausgebildeter,
modellhafter Professionen. Hierzu gehören vor allem die Ärzteschaft
und die Juristen (vgl. zum folgenden ausführlicher Bauer/Burkard
1992).
Professionalität erfordert Autonomie, das heißt Entscheidungsspielräume über
die eigenen Arbeitsbedingungen, über die Formen des Umgangs mit
Klienten, über Maßnahmen und Empfehlungen. Autonomie braucht
einen Gegenspieler, der dafür sorgt, dass Spielräume und Freiheiten
nicht als Privilegien missbraucht werden. Dieser Gegenspieler ist das
Berufsethos. Der Fortfall äußerer Kontrollen muss durch Selbststeuerung
kompensiert werden. Und Selbststeuerung beruht auf der Bindung an überpersönliche
Werte, im Falle des Pädagogen etwa die Selbständigkeit und
Mündigkeit des Heranwachsenden oder, noch allgemeiner, das Wohl
des Klienten.
Reflexivität und Supervision kommen als weitere Merkmale einer modernen
Profession in sozialen Aufgabenfeldern hinzu. Wissen, was man tut, deutlich
wahrnehmen, wie man handelt, diese Stufen der Hinwendung zum eigenen
Handeln sind keineswegs alltäglich und selbstverständlich.
Sie setzen vielmehr eine besondere Haltung voraus, die durch die berufliche
Sozialisation gefördert werden kann.
Kooperation als weiteres Merkmal von Professionalität bezieht sich
zum einen auf die Ebene der interprofessionellen Zusammenarbeit. Dazu
gehört die Kooperation mit Fachleuten aus den Bereichen Forschung,
Beratung, psychosoziale Dienste usw. Zum anderen bezieht sich Kooperation
auf die intraprofessionelle Zusammenarbeit mit Kollegen der eigenen Berufsgruppe.
Was diese betrifft, zeigen empirische Untersuchungen immer wieder, dass
die Zusammenarbeit meist auf die Ebene der Unterrichtsvorbereitung beschränkt
bleibt. Gegenseitige Hospitationen und Team ‑ teaching finden
nur an wenigen Schulen statt (Bauer/Bussigel/Pardon/Rolff 1979, S. 113
ff, Schwänke 1988, S. 142, Roth 1994). Allerdings zeigt sich, dass
dort, wo besondere Anstrengungen zur Verstärkung von Kooperation
unternommen werden, sich das tatsächliche Kooperationsverhalten
auch langfristig ändert (Alterinann ‑ Köster 1990, S.
110, Roth 1994).
Am umstrittensten von den genannten Kriterien dürfte bei Pädagogen
der Bezug auf eine Berufswissenschaft sein, also die wissenschaftliche
Basis der Berufsausübung. Während allgemein akzeptiert sein
dürfte, dass Ärzte naturwissenschaftliche, insbesondere biologische
und physiologische Grundkenntnisse brauchen, dürfte es für
Pädagogen keinen vergleichbar unumstrittenen Bereich des Grundwissens
geben.
Im Rahmen unseres empirischen Forschungsvorhabens ist dies eine der zentralen
Fragen: Bestehen Verbindungen zwischen Handlungs‑ und Begründungswissen
von Lehrerinnen und Lehrern und wissenschaftlichem Wissen sowie wissenschaftlichen
Einstellungen und Sichtweisen? Welche Vorteile oder Nachteile haben solche
Verknüpfungen von Berufswissen und wissenschaftlichem Wissen?
Aufgrund der vorliegenden empirischen Studien lässt sich begründet
vermuten: Aus der Perspektive des kriterienbezogenen Ansatzes erweist
sich Lehrerarbeit in den Bereichen Kooperation, Berufswissenschaft und
Berufssprache als defizitär.
Historischer Ansatz
Dieser Ansatz fragt vor allem nach den Strategien, mit denen eine Berufsgruppe
Konkurrenten aus dem Feld schlägt oder verdrängt und sich einen
Anspruch auf bestimmte Tätigkeiten und die damit verbundenen Vorrechte
sichert.
Aus der Sicht des historischen Ansatzes betrachtet, sind erziehungswissenschaftlich
gebildete Pädagogen "Spätkömmlinge", die mit
Angehörigen anderer Berufsgruppen (Psychologen, Sozialwissenschaftler,
Gymnasiallehrer) konkurrieren müssen. Lehrer, die ihren Anspruch
auf Berufsausübung nicht aus einer erziehungswissenschaftlichen
Bildung ableiten, können sich zwar auf Traditionen berufen, deren
Glaubwürdigkeit ist aber ins Wanken geraten. Dies gilt insbesondere
für die in Deutschland übliche Beamtenlaufbahn mit dem ersten
und zweiten Staatsexamen als Zugangsvoraussetzung. Staatlicherseits definierte
Professionen wie der deutsche Lehrerstand sind eine historische Besonderheit
und in vielen anderen Ländern entweder erst gar nicht entstanden
(USA, Kanada, Niederlande, Großbritannien) oder inzwischen durch
flexiblere Formen der Rekrutierung abgelöst worden (Siegrist 1990).
Wir vermuten einen Zusammenhang zwischen der (unzureichenden) Lehrerprofessionalität
und dem Status der Erziehungswissenschaft im Gesamtgefüge der Wissenschaften.
Dieser Status lässt sich durch die Merkmale "neu, expansiv,
noch wenig anerkannt" beschreiben (vgl. hierzu Krüger/Rauschenbach 1994). Bemerkenswert ist die Zunahme der Praxisorientierung des Faches
und seiner Vertreter bei stagnierenden Werten in den Bereichen theoretisch‑historische
und empirische Orientierung (Baumert / Roeder 1994). Möglicherweise
ist das Potential der Erziehungswissenschaft für die Lehrerbildung
noch unerschlossen.
Auf Arbeitsaufgaben bezogener Ansatz
Grundlage dieses Ansatzes sind empirische Studien, in denen vorrangig folgende Fragen untersucht werden:
- Welche Arbeitsaufgaben haben die Angehörigen einer Berufsgruppe?
- Wie werden diese Arbeitsaufgaben bewältigt?
- Welche Fähigkeiten sind dazu erforderlich?
- Wie werden diese Fähigkeiten erworben und verbessert?
Eine herausragende Forschungsrichtung, die sich mit
der Bewältigung
eines bestimmten Typs von Arbeitsaufgaben befasst, ist der "Expertenansatz" (Bromme
1992). Der Expertenansatz fragt nach Wissenstrukturen, durch die sich
Experten von Laien, erfahrene Mitglieder einer Berufsgruppe von Anfängern
unterscheiden, oder er fragt nach Spitzenleistungen, die wiederholt erbracht
werden.
Eine zentrale Arbeitsaufgabe, die Lehrerinnen und Lehrer bewältigen
müssen, ist die Herstellung und Aufrechterhaltung einer Struktur,
einer Ordnung für die aufgabenbezogenen Interaktionen in Lerngruppen.
Diese Aufgabe wird als Unterrichtsführung oder "classroom management" bezeichnet
(Doyle 1986). Weitere Aufgaben sind die Entwicklung des Stoffes und die
Strukturierung der Unterrichtszeit (Bromme 1992, S. 77 ff.).
Im folgenden entwickeln wir einen Begriff der pädagogischen Professionalität,
der Elemente des kriterienbezogenen Ansatzes, der auf Arbeitsaufgaben
bezogenen Forschung und des Expertenmodells miteinander verbindet. Methodisch
gehen wir so vor, dass wir erfahrene Lehrerinnen und Lehrer, die ihre
Arbeitsaufgaben gut bewältigen, mit Lehrerinnen und Lehrern vergleichen,
die Weniger erfolgreich im Umgang mit Arbeitsaufgaben sind.
Bevor wir ein Ergebnis unserer Arbeit, eine vorläufige Definition
von pädagogischer Professionalität darstellen, müssen
wir zwei Begriffe klären, die in unsere Definition als wesentliche
Komponenten Eingang finden.
Das pädagogische Handlungsrepertoire
Damit sind Handlungsmuster gemeint, die auf hoch verdichteten
Wissensbeständen
basieren, also während der Handlungsausführung nicht vollständig
ins Bewusstsein gelangen. Die Handlungsabfolgen sind geübt und wirken
auf den Betrachter gekonnt.
Das Handlungsrepertoire ist individuell und führt zu einem persönlichen
Stil. Pädagogen, die sehr expressiv vor der Lerngruppe auftreten,
verfügen über ein gestisches und mimisches Ausdrucksrepertoire,
mit dem sie die Aufmerksamkeit der Lernenden wecken und aufrechterhalten
können. Andere haben ein ausgefeiltes Repertoire im Umgang mit wechselnden
sozialen Situationen und Unterrichtsformen entwickelt. Und eine dritte
Gruppe gestaltet die physikalische Umgebung der Lerngruppe zu einer anregenden
und zugleich die Konzentration fördernden Lernumwelt. Die wichtigsten
Dimensionen des Handlungsrepertoires werden in den folgenden Kapiteln
noch beschrieben und durch Fallbeispiele belegt.
Das professionelle Selbst
Das professionelle Selbst ist den übrigen Komponenten der Professionalität übergeordnet.
Es hat eine strukturierende und integrierende Funktion, ohne die jede
noch so differenzierte Teilkompetenz methodischer oder technischer Art
aufgesetzt wirken würde. Was ist dieses berufliche Selbst? Wie arbeitet
es? Welche Aufgaben nimmt es wahr? Wie entsteht es?
Zur Beantwortung dieser Fragen haben wir Theorien des Selbst aus den
Bereichen Kybernetik (Vester 1986), Neurowissenschaften (Edelman 1995)
und Psychologie (Csikzentmihalyi 1995) herangezogen.
Neurowissenschaftlich betrachtet, ist das Selbst eine Funktion des höheren
Bewusstseins. Höheres Bewusstsein entsteht, wenn im Zentralnervensystem
aktuelle Informationen mit Gedächtnisinhalten verknüpft und
unter emotionaler Beteiligung bewertet werden. Wahrscheinlich ist das
höhere Bewusstsein aus dem primären Bewusstsein hervorgegangen.
Das primäre Bewusstsein steuert die Aufmerksamkeit, indem es einlaufende
Informationen mit Zielen und Handlungsentwürfen verknüpft und
durch vergleichende Bewertung Auswahlentscheidungen trifft. Vereinfacht
gesagt: "Wir sind, was wir beachten" (Csikzentmihalyi 1995,
S.284).
Ein professionelles Bewusstsein ist demzufolge die integrierende und
auswählende Instanz, die die Aufmerksamkeit eines Pädagogen
so steuert, dass Informationen verarbeitet und Handlungsmuster ausgewählt
werden, die im Hinblick auf pädagogische Ziele relevant sind. Es
ist sinnvoll, zwischen einem primären und einem höheren professionellen
Bewußtsein und unterscheiden.
Das primäre professionelle Bewußtsein entsteht aus der pädagogischen
Interaktion und begleitet die Aufgabenerfüllung. Das höhere
professionelle Bewußtsein entsteht durch die Verarbeitung von Erinnerungen.
Es setzt Reflexion voraus und ist in hohem Maße sprachgebunden.
Ein professionelles Selbst entsteht aus dem höheren professionellen
Bewußtsein. Wenn diese Annahmen zutreffen, ergeben sich einige
weitreichende praktische und forschungsmethodische Konsequenzen.
Forschungsmethodisch ergibt sich die Konsequenz, dass das professionelle
Selbst, da es Teil des Bewusstseins ist, der Reflexion zugänglich
ist und beispielsweise durch Interviews, die Auswertung von Tagebuchmaterial
usw. erforscht werden kann.
Praktisch ergibt sich die Konsequenz, dass die Entwicklung des professionellen
Selbst durch das Individuum kontrolliert und höchstwahrscheinlich
durch Maßnahmen der Fortbildung gefördert werden kann.
Die vorrangige Aufgabe des professionellen Selbst besteht ‑ der
Theorie zufolge ‑darin, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden.
Dies setzt eine klare interne pädagogische Zielorientierung voraus.
Und es setzt voraus, dass einlaufende Hinweise und Informationen im Hinblick
auf pädagogische Handlungsmöglichkeiten wirksam kategorisiert
werden können. Nach diesem Exkurs folgt nun unsere Definition pädagogischer
Professionalität:
Pädagogisch professionell handelt eine Person, die gezielt ein berufliches Selbst aufbaut das sich an berufstypischen Werten orientiert, sich eines umfassenden pädagogischen Handlungsrepertoires zur Bewältigung von Arbeitsaufgaben sicher ist, sich mit sich und anderen Angehörigen der Berufsgruppe Pädagogen in einer nicht‑alltäglichen Berufssprache verständigt, ihre Handlungen unter Bezug auf eine Berufswissenschaft begründen kann und persönlich die Verantwortung für Handlungsfolgen in ihrem Einflussbereich übernimmt.
Die nachstehende Abbildung soll die Komponenten unserer Definition verdeutlichen und eine erste Andeutung der Komplexität möglicher Beziehungen zwischen dem professionellen Selbst und den Bereichen, in denen es agiert und lernt, liefern.
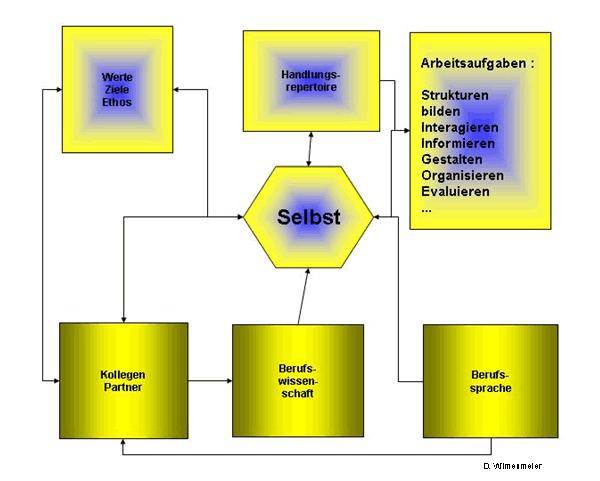
Bei den Richtungspfeilen in der vorstehenden Abbildung haben wir versucht,
eine Hauptrichtung anzugeben. Auch bei einseitig gerichteten Pfeilen
kann eine Rückkoppelung bestehen. Hervorgehoben werden in der Grafik
aber nicht die Rückkoppelungsbeziehungen, sondern die Richtung der
Aktivität. Nur wo die Aktivitäten in etwa gleicher Intensität
in beide Richtungen weisen, haben wir Doppelpfeile verwendet.
Die im Zentrum dunkel unterlegten Komponenten sind interne Bereiche oder
Dimensionen, die dort hellen Komponenten extern und Teil der Umgebungskultur
von Lehrerinnen und Lehrern.
Das Handlungsrepertoire kann direkt, ohne Kontrolle des Selbst, zur Bewältigung
von Arbeitsaufgaben abgerufen werden. In diesem Fall handelt es sich
um Automatismen, die dem Selbst unmittelbar nicht oder nicht mehr zugänglich
sind, wohl aber bewusst gemacht werden können und dann ‑ unter
günstigen Rahmenbedingungen ‑ auch kontrolliert werden können.
Wir haben in diese Definition die wichtigsten Komponenten des oben aus
der Literatur entnommenen Professionsbegriffs einbezogen. Neu an unserer
Definition ist die besondere Bedeutung eines beruflichen Selbst, das
im Zentrum steht und die übrigen Komponenten organisiert. Neu ist
auch die Hervorhebung des pädagogischen Handlungsrepertoires.
pdf der Seite