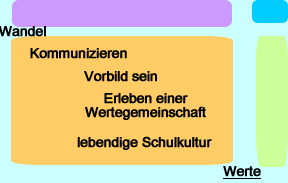Inhalt:
- Problemaufriss
- Janusz Korczak
1. Problemaufriss
Unter "Persona" verstand man im alten griechischen Theater den Schauspieler, der eine Maske trug und damit jemanden repräsentierte. Diese Auffassung entspricht in etwa dem soziologischen Rollenkonzept. Das Rollenmodell erklärt zwar verschiedene Verhaltensweisen/ Auftrittsweisen in verschiedenen Situationen und erklärt damit verbundene Rollenkonflikte (vergl. Geißler), doch greift es etwas zu kurz. Auch wenn ich verschiedene nebeneinander berufliche/private Rollen spiele, so habe ich persönliche den Eindruck, diese passt zu mir, die übe ich ungern aus, das kann ich nicht, ... Wir haben als ein "Metabewusstsein", eine "Metaerzählung" von dem, was mir entspricht, was zu mir passt bzw. nicht passt. "Mein wirkliches Selbst".
Verschiedene Schulen der Psychologie versuchen diese Selbsterfahrung und ihre Entstehung zu objektivieren.
In der der Persönlichkeitspsychologie wurde sehr lange der Begriff Charakter zur Beschreibung von Wesensmerkmalen eingesetzt. Der moderne Persönlichkeitsbegriff wurde je nach Schule als veränderbare "Charakterausstattung" bzw. als stabiles , mehr oder minder kaum veränderbare Merkmale eines Individuums angesehen. Die Präsentation stellt die Grundzüge für die empirische Konstruktion des Begriffes Persönlichkeit zur Verfügung und erläutert, wie Typisierungen gebildet werden.
Wiederum gehen heutige medizinisch orientierte Ansätze davon aus, dass wir nicht nur eine sondern mehrere Persönlichkeit haben , die sich in verschiedenen Kontexten zeigen. Das "Selbst" - ein neuerer Begriff - wiederum sei nur eine Fiktion des Gehirns, dass mein Handeln in einen Zusammenhang stellt, das einen zeitlich übergreifenden Akteur vorgaukelt. (Wir benötigen eine Instanz, die uns "erzählt", dass das Kind auf dem Bild und die Person, die sich im Spiegel betrachtet, die gleiche Person ist. Bei bestimmten Krankheitsbildern, verlieren Menschen ihre Vergangenheit bzw. ihre Zukunft.) Wir erzählen uns eine Geschichte "Das bin ich" und wenn ich mal "daneben lag", sagen wir von uns bzw. andere von uns "Das war nicht ich. Das war der Alkohol, ..."
Zur Entwicklung des Persönlichkeitsbildes verfolgen sie bitte die verschiedenen Aufsätze.
Warum Persönlichkeit als Thema der Lehrerausbildung?
1. Im pädagogischen Bereich werden seit alters her besondere Ansprüche an die Persönlichkeit eines Erziehers, Pädagogen bzw. Lehrers gestellt, da der Umgang mit meist jüngeren, abhängigen Personen ein großes Gefährdungspotential besitzt. Dieses Gefährdungspotential ist wechselseitig, wie es beispielhaft in den Gegensatzpaaren "Macht - Ohnmacht", "Freiheit - Abhängigkeit", "Zuneigung - Ablehnung" etc. verdeutlicht werden kann.
2. Im Allgemeinen ist die Persönlichkeit des Lehrers der nonverbale Faktor, der den pädagogischen Bezug entscheidend prägt. Das Lernen am Vorbild ist empirisch abgesichert (vergl.bei den Lerntheorien Bandura) ein wirksames Element im Unterricht. Wenn Sie zudem die 10 Merkmale des guten Unterrichts heranziehen, sind natürlich auch Strukturiertheit, ... mit Wesenszügen der Lehrperson verknüpft.
3. Da aber die Persönlichkeit zum großen Teil - nach Aussagen der Persönlichkeitspsychologen und der modernen Hirnforschung - ein kaum veränderbarerer, stabiler Zug ist, ergibt sich damit auch die Frage: "Sind alle Personen für das Berufsfeld Erziehung geeignet?
4. Wir alle bringen in den Unterricht unsere subjektiven Theorien über uns, über die Schüler/Eltern, ... ein. Die Kenntnis der "der eigenen Stärken/Fallen in mir" gehören zur Grundausstattung von Professionalität (vergl,. den Abschnitt über Korczak).
These: Reflexion der eigenen Lern- und Entwicklungsbiographie sind eine unabdingbare Voraussetzung für das professionelle Selbstbild und die Berufsausübung.
Ein biographisches Beispiel für einen Erzieher, der die eigenen Bedürfnisse im erzieherischen Bezug verwirklicht, war Janusz Korcak. Diese idealtypische Person, sollte aber im Sinne eines professionellen Verhältnisses auch kritisch betrachtet werden.
Aufsätze zur Lehrerpersönlichkeit durch die Jahrhunderte und zur Problematik des Begriffes finden Sie in den Registerkarten unten.
Durch die Präsentation bewegen Sie sich mit Hilfe der Pfeiltaste von Folie zu Folie.
2. Janusz Korczak ein Beispiel
2.a. Janusz Korczak ( 1878-1942)
Erziehungsziel:
- Freie Entfaltung aller menschlichen Anlagen
- Welt ohne Unterdrückung
- Gegenseitige Achtung
- Anerkennung der Einzigartigkeit jeder Person
- Befreiung der Kinder aus dem Zustand der Unterdrückung
- Kinder brauchen Möglichkeiten zur Selbstbestimmung; sie müssen lernen, Verantwortung zu übernehmen
Schlüsselbegriffe:
Rechte des Kindes :
- Recht auf Tod
- Recht auf den heutigen Tag
- Recht des Kindes, so zu sein, wie es ist
- Vorbehaltlose Liebe
- Kameradschaftsgericht
- Parlament
- Tafel
- Dienste
- Briefkasten
- Korczak steht ganz in der Tradition der Pädagogik „Vom Kinde aus“ (Ellen Key, Berthold Otto)
- Steht Pestalozzi nahe
Standortbestimmung:
Zum Nachdenken: Sätze von Korczak:
- Ist unser Verhältnis zu den Kindern vielleicht nicht ein Ausdruck des Egozentrismus der Erwachsenen?
- Wie oft gleichen wir dem Kinde, das der Katze eine Schleife an den Schwanz gebunden hat, sie mit einer Birne füttert, ihr seine Zeichnungen zeigt und verwundert ist, dass die Undankbare sich taktvoll verdrücken will oder verzweifelt zu kratzen anfängt.
- Einer der schlimmsten Fehler besteht darin anzunehmen, dass die Pädagogik eine Lehre über das Kind und nicht eine Lehre über den Menschen sei.
Literatur:
„Wie man ein Kind lieben soll“ (Göttingen 1979)
„Das Recht des Kindes auf Achtung“ (Göttingen
1973)
2.b. Der Erzieher bei Janusz Korczak
Die ganze moderne Pädagogik
trachtet danach, bequeme Kinder heranzubilden, sie strebt konsequent
und Schritt für Schritt danach, alles einzuschläfern, zu
unterdrücken
und auszumerzen, was Willen und Freiheit des Kindes ausmacht, seine
Seelenstärke, die Kräfte seines Verlangens und seiner Absichten.
Artig, gehorsam, gut, bequem, aber ohne einen Gedanken daran, dass
es innerlich unfrei und lebensuntüchtig sein wird.
[1; S. 12]
Diese Zitat umfasst die ganze Bandbreite der Auseinandersetzung von J. Korczak mit der zeitgenössischen Pädagogik. "Vom Kinde aus" argumentiert er für die Stärkung des kindlichen Selbst. Damit zeigen sich erstaunliche Parallelen zu den Beobachtungen und Forderungen der Humanistischen Psychologie und Pädagogik der letzten Jahre:
Der vermutlich wichtigste Beitrag der humanistischen
Psychologie der letzten dreißig Jahre ist die Betonung des Selbst-Konzeptes
als Faktor des menschlichen Wachstums und Verhaltens. Das Selbstbild
und die Grundannahmen über sich selbst sind ein vitaler Bestandteil
jeder Aktivität eines Individuums.
Menschen verhalten sich nachdem, was sie über sich selbst annehmen.
Diejenigen, die glauben, dass sie etwas können, können es; die, welche
es nicht glauben, können es nicht.
Ausführliche Forschung hat uns gezeigt, dass das Selbstkonzept ein
zentraler Faktor beim Erfolg oder Misserfolg eines Menschen in der
Schule, im Beruf oder in der sozialen Interaktion darstellt.
[2; S. 65]
Die Überschneidung von Korczaks Ideen
mit den Gedanken der Humanistischen Pädagogik näher herauszuarbeiten
und die Anforderungen an das Erzieherverhalten zu präzisieren, soll
das Ziel des Beitrags sein.
Zu diesem Zwecke werden exemplarisch die Forderungen Korczaks vorgestellt
und mit denen der Humanistischen Richtung verglichen.
Dabei soll aber nie vergessen werden, dass Korczak selbst seine Forderungen
vor lebte.
Der Einfachheit halber gehe ich von der praktischen "Erzieherpersönlichkeit"
aus, weil sich Verhalten nur in der Interaktion mit anderen zeigt.
1. Forderungen an die Persönlichkeit des Erziehers.
1.1. Sei unvoreingenommen:
Du, der du schon mit Kindern zu tuns
hast, du sollst dich lieber freuen! Du bist schon dabei, deine Vorurteile,
deine sentimentalen Ansichten über Kinder aufzugeben. Du weißt
bereits, dass du nichts weißt. Kinder sind nicht so wie du
gemeint hast, sie sind ganz anders.
Die Achtung des Anderen verlangt die
Respektierung und Würdigung des anderen Menschen als einzigartigem
Wesen [3].
Eigene Denkschemata werden zu schnell dem Anderen übergestülpt.
Dabei wird leicht übersehen, dass der Andere in seinem Anderssein
eigene Entwicklungsmöglichkeiten besitzt. Er hat mit seinen spezifische
Stärken auch das Recht, auf den eigenen Weg. Aus dieser Forderung
Korczaks ergibt sich auch logisch seine zweite.
1.2. Erkenne Dich selbst:
Habe Mut zu dir selbst und such deinen eigenen Weg. Erkenne dich selbst, bevor du die Kinder zu erkennen trachtest.Leg dir Rechenschaft darüber ab, wo deine Fähigkeiten liegen, bevor du damit beginnst, Kindern ihre Rechte und Pflichten abzustecken.
Unter ihnen bist du selbst ein Kind, dass du zunächst einmal erkennen, erziehen und ausbilden musst.
Da jeder Mensch einzigartig ist, kann sich auch jeder
Erzieher entscheiden, seinen ihm gemäßen Erzieherstil zu
erwerben. Den Weg dazu kann er in diesem Sinne nur finden, wenn er
selbst Zugang zu seinen eigenen kindlichen Erfahrungen, Ängsten,
Nöten
und Freuden hat.
Verletzungen (etwa des Kind-Ichs im Sprachgebrauch der TA [4]) in
der Kindheit
zu erkennen und sich mit ihnen zu versöhnen, setzt Risikobereitschaft voraus.
Das ist eine Absage an genau definierte Erziehungsmethoden, die für jedes
Kind und für jeden Erzieher zu gleichen Ergebnissen führen.
Gleichzeitig besteht jederzeit "Verletzungsgefahr - Versagensgefahr": Die Angst "Fehler" zu
machen und auch die Angst wegen etwaiger "Fehler" angegriffen zu
werden.
Du wirst all diese Fehler begehen; denn nur der allein begeht keine Fehler, der überhaupt nichts tut.
"Gute Erzieher" unterscheiden sich von schlechten Erziehern durch die Anzahl der begangenen Fehler, des begangenen Unrechts. Der erstere begeht einen Fehler nur wenige Mal und ist sich dessen bewusst. Er steht zu ihnen, während der "schlechte" Erzieher den "Kindern die Schuld am eigenen versehen gibt" [1; S.182].
Korczak sieht wie die Humanistische Psychologie, dass "Fehler" die
Möglichkeit der Veränderung bis hin zu persönlichem Wachstum bieten.
Jeder Erzieher hat eine wichtige Ressource in sich: Das Kind, das es
zu entwickeln gilt. Im Spiel, Rollenspiel und Theater, wird es beim
Erwachsenen
mehr oder minder sichtbar ( "Er kann spielen")
Wer noch "ein Kind", die "Jugend" in sich hat, besitzt also
noch einen "einen
wundertätigen Bundesgenossen, einen Zauberer gar in sich", der "...
der kritischen, unbeholfenen Erfahrung" weit überlegen ist [1;
S. 157]
Aufgabe des Erziehers ist es also, dieses Kind in sich wieder zu finden und zu beleben.
1.3 Sei du selbst:
Wenn es dem Erzieher gelingt, sich selbst zu erkennen, steht er auch zu sich selbst. Er setzt seine Kräfte und Stärken in angemessener Weise um. Erkannte "Schwächen" werden zu Helfern auf dem Entwicklungsweg. Nach Carl Rogers [3] handelt er jetzt kongruent: verbales und nonverbales Verhalten bilden eine Einheit. Beziehungsfallen (double binds [siehe 5]) werden erkannt und vermieden. Oder er vermeidet in der Rolle des Erziehers, sich einfach lächerlich zu machen:
Du sollst ihr Vorbild sein; aber wie
kannst du dich vor deinen Fehlern, deinen lächerlichen und schlechten
Gewohnheiten hüten?
Du wirst sie zu verbergen suchen. Gewiss wird dir das gelingen; je
sorgsamer du sie verbirgst, um so eifriger werden sich die Kinder
so verhalten, als bemerkte sie gar nichts; aber im leisen Flüsterton
werden sie dich verspotten.
Wie bei der Humanistischen Psychologie gibt es nicht "die eine richtige Lösung" für das Verhalten in schwierigen Situationen. Es gibt nur menschliche Stärken (Ressourcen) z.B. Demut, Geduld und Humor, die Alternativen zur Lösung der alltäglichen Schwierigkeiten anbieten.
Wenn du keine achtungsgebietende Statur und keine starke Lunge besitzt, wirst du dich vergeblich bemühen, mit erhobener Stimme den Lärm einer Kinderschar zu übertönen. Du hast ein gütiges Lächeln und Augen, aus denen Geduld spricht - sage nichts. vielleicht geben sie von sich aus Ruhe. Sie suchen sich ihren eigen Weg.
Das Vertrauen in die Entwicklung des anderen,
dass dieser von sich aus Lösungen finden kann, entspricht der
Einsicht, dass nur der Gegenüber "die Lösung auch in
sich hat". Deshalb wird
der Erzieher in schwierigen Situationen auf sich zurückgeworfen,
er hält seine Lösungsvorschläge zurück und "provoziert" die
Nachdenkvorgänge
beim Gegenüber.
Ein idealer Erzieher bleibt mit all seinen Fehlern Mensch und kann
deshalb sogar im Misslingen ein Beispiel werden, wenn er zeigt, wie
er mit seinen Schwächen umgeht.
1.4. Entscheide dich:
Im Unterricht sind fortlaufend Entscheidungen
zu treffen. Jede Entscheidungssituation ist neu oder unterscheidet
sich in Kleinigkeiten von einer bereits bekannten. Das Handeln nach
der Entscheidung ist offen, die Auswirkungen ungewiss.
Entscheidungen, die nach Tausch & Tausch [6]
die Variablen Wärme, Einfühlungsvermögen, Achtung, Rücksichtnahme,
Verstehen und Echtheit (Kongruenz) berücksichtigen, tragen zu einer konstruktiven
Persönlichkeitsentwicklung bei.
Da vor der Entscheidung jedoch die Analyse der
Situation steht, verlangt Korczak von einem Erzieher, dass er in der
Lage ist, genau die Sachverhalte zu beobachten.
Sensorische Daten können
dem Erzieher manchmal mehr verraten als die pädagogische Theorie.
Im Seminar der Bursa schulte er deshalb seine Erzieher in der Beobachtung
"... kleiner Vorkommnisse, scheinbar unbedeutender Fakten, die
aber in Wirklichkeit sehr aufschlussreich sind ..." [6; S. 174]
Den Wert der neutralen, genauen Beobachtung lernte er
als Arzt kennen:
Ich sehe es mir an; gebe ein paar Anweisungen, beantworte einige Fragen. Es ist ja gesund, lieb und fröhlich. "Auf Wiedersehen!"
Noch am selben Morgen oder am Tag: "Herr Doktor mein Kind hat Fieber."
Die Mutter hat bemerkt, was ich als Arzt bei einer oberflächlichen Untersuchung während der kurzen Visite nicht entdecken konnte. Stundenlang über das Kleine gebeugt, ohne Kenntnis von Beobachtungsmethoden, weiss sie nicht, was sie wahrgenommen hat, sich selbst misstrauend, wagt sie es nicht, sich zu ihren eigenen subtilen Beobachtungsmethoden zu bekennen. Und sie war darauf aufmerksam geworden, dass das Kind, ohne eigentlich heißer zu sein, doch eine etwas mattere Stimme hatte. Es plapperte seltener und ein bisschen leiser ....
Weitere Beispiele für Korczaks Beobachtungsmethoden auf 1 S. 220 ff.]
Eine Berücksichtigung feinster ( oder auch gröberer) physiologischer Veränderungen und die Beobachtung weiterer nonverbaler Hinweisreize sind Werkzeuge der "Neuen Hypnose" nach Milton H. Erickson und im NLP. Das Erkennen verschiedener Zustände und die Nutzung von Lernphysiologien bzw. das Unterbrechen von Angstphysiologien beschreibt unter vielen anderen M. Grinder.
1.5. Widme dich ganz den Kindern
Was sind deine Pflichten?Wachsam sein. Wenn du Aufseher sein willst, brauchst du nichts zu tun. Wenn du ein Erzieher bist, dann hast du einen sechzehnstündigen Arbeitstag, ohne Pause, ohne Feiertag - einen Tag, der aus Arbeiten besteht, die sich weder beschreiben noch wahrnehmen noch kontrollieren lassen, und aus Worten, Gedanken und Gefühlen besteht, die tausend Namen haben.
Äußere Ordnung, dem Anschein nach gutes Benehmen, Disziplin, die sich sehen lassen kann -, dazu bedarf es nur einer harten Hand und zahlreicher verbote.
Und die Kinder sind immer Märtyrer der Besorgnis um ihr angebliches Wohlergehen; das schlimmste Unrecht hat hier ihren Ursprung.
In Abgrenzung zu den allgemein anerkannten Erziehungszielen im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts ist der Erzieher nach Korczak am Kinde orientiert. Um der Aufgabe aber zu genügen, ist er aber auch verpflichtet, seine Kraft einzuteilen:
Wenn ein Erzieher günstige Arbeitsbedingungen vorfindet - um so besser. Wenn sie aber so sind, wie ich sie beschrieb, dann soll er seine Kraft und Energie vernünftig einteilen - sie muss eine längere Zeit als die ersten paar Monate reichen.Im Extrem führt das Erzieherideal bei
Korczak dazu, dass sich ein Erzieher nicht durch die Schwierigkeiten
belasten soll, die ein eigenes Familienleben mit sich bringt. Dieser
"ideale Erzieher" verzichtet auf sein Intim- und Privatleben im Dienste
seiner Schüler.
(Die Forderung nach dem Zölibat der Lehrkräfte stellten auch die Kinder
von Barbiana).
Dieser Anspruch wird sich wohl heute nicht mehr durchsetzen lassen,
doch ist seine Argumentation auch heute noch nachvollziehbar. Bitte
überlegen Sie sich, wie häufig private Probleme der Lehrkräfte
mit in die Schule gebracht werden und den Umgang mit den Schülern
oft negativ beeinflussen. Auf der anderen Seite, unterbleibt nicht
manche Problemlösung,
weil die Lehrkraft "keine Zeit" mehr hat ?
[Zur weiteren Diskussion S. 6; S. 236 F.]
2. Persönlichkeitsbildung in der Lehrerbildung
Die nur kurz zusammengefassten Persönlichkeitsmerkmale nach Korczak verlangen ein intensives Training in der Selbst- und Fremdwahrnehmung. Kenntnis der eigenen Biografie und der eigenen Lernerfahrungen helfen den anvertrauten Kinder/ Schüler unvoreingenommen zu begegnen,.
A. Combs [in 2; S. 255 f] kam bei der Untersuchung von "gutem" und "schlechtem" Lehrerverhalten zu ähnlichen Ergebnissen:
- Der "gute" Lehrer sieht sich eher positiv als negativ.
- Er sieht seine Probleme eher von einem internen als von einem externen Bezugsrahmen, d.h. er sieht es als wichtiger an, wie die Dinge für einen Schüler aussehen als für den Lehrer. (Empathie)
- "Gute" Lehrer sehen andere Menschen eher als positiv: als freundlich, fähig, vertrauenswürdig etc. während "schlechte" Lehrer Zweifel bezüglich der Fähigkeiten ihrer Schüler haben.
- Die Unterrichtsziele "guter" Lehrer sind eher befreiend, öffnend, ausweitend, während "schlechte" Lehrer eher einengende, kontrollierende und direktive Ziele verfolgen.
- "Gute" Lehrer können auf der Basis der Echtheit von Methoden, die sie verwenden, unterschieden werden. Wichtig scheint hier zu sein, dass der "gute" Lehrer echt ist in der Wahl der jeweiligen Methode, die zu ihm und den Umständen passt.
Aus dieser Analyse heraus entwickelte A. Combs folgende Grundsätze der Lehrerausbildung für seine "Florida-Gruppe":
- Die Entwicklung eines effektiven Lehrers ist ein "Prozess des Werdens" nicht der Perfektion.
- Der Prozess des Werdens baut auf einem Gefühl der Sicherheit und Akzeptanz auf.
- Die Lehrerausbildung baut mehr auf der subjektiven Erfahrung auf. Verhaltensschulung ist sekundär.
- Um wirkungsvoll mit subjektiver Erfahrung umzugehen, betonen diese Lehrerprogramme die subjektiven Aspekte der menschlichen Erfahrung.
- Ein individualisiertes Programm baut auf einem offenen Denksystem auf, persönliches Entdecken wird möglich.
- Das "Lernen von Bedürfnissen" spielt eine bedeutsame Rolle.
- Entdeckendes Lernen bedingt eine aktive Beteiligung der Studierenden.
- Weil das Selbstkonzept nach den empirischen Forschungen eine wesentliche Rolle im Lehrerverhalten spielt, wird in der Ausbildung darüber nachgedacht.
- Da Unterrichtsmethoden eine persönliche Art, sich selbst einzusetzen, darstellen, können sie nicht vorgegeben werden, sondern müssen entdeckt werden.
- Da Studenten mit allen möglichen Erfahrungshintergründen zur Lehrerausbildung kommen, sollte eine professionelle Ausbildung auch die Möglichkeit zu möglichst breitem Lernen bieten.
- Da Leute am besten aus ihrer eigenen Erfahrungen lernen, sollte ein Lehrerausbildungssystem in seiner Grundphilosophie und Praxis auf einer Vielfalt von möglichen Modellen aufbauen.
Wie Korczak betont Combs die subjektive Wahrnehmung
des Erziehungsprozesses, die aktive Auseinandersetzung mit den eigenen
Erfahrungen, die Offenheit des Ausgangs. Er sieht als Ergebnis des
Ausbildungsprozesses Menschen, die offen auf andere zugehen und die
Mitmenschen von ihren positiven Ansätzen her betrachten.
Die allumfassende,
selbstverleugnende Liebe Korczaks ist aber mehr.
3. Aufgaben des Erziehers
3.1.Rahmen schaffen,
in denen sich Kinder bewegen
und an denen sie sich orientieren können:
In loser Gruppierung ohne feste Organisation vermögen
nur wenige, außergewöhnliche Kinder zu gedeihen und sich zu entwickeln;
aber Dutzende verkümmern dabei.
Ein Erzieher hat also die Aufgabe, Kindergemeinschaften
zu strukturieren und damit das Zusammenleben der Kinder zu erleichtern.
Eine Ordnung ist deshalb kein Selbstzweck:
Sie schützt jedes einzelne Kind, besonders das "schwache".
Treten neue bedürfnisse auf, kann sie jederzeit verändert,
den neuen Bedürfnissen
angepasst werden. Die Ordnung gewährt dem Kind Sicherheit / vergl.
dazu die Ausführungen zum" handelnden Hirn"). Verstößt
der Erzieher selbst gegen die Ordnung, wird er bei Korczak dem "Gericht"
unterworfen.
Im Selbstverwaltungssystem Korczaks lernen
Kinder miteinander reden, Konflikte auszutragen und angestellte Schäden
wieder gut zu machen. Sie begreifen sich, um mit Bandura oder Seligman zu
sprechen, als "Selbstverursacher".
Aus dieser Haltung heraus ist der Einsatz der Erziehungsmittel Verbot bzw. Gebot,
sehr sorgfältig zu überlegen. Es besteht die Gefahr, dass Verbote und
Gebote aus einer augenblicklichen Laune heraus entstehen. Solche Gebote
und Verbote sind dann schwer einzuhalten.
Von der Entwicklung des Kindes her betrachtet, waren Verbote ursprünglich zum Schutz vor Gefahren ausgesprochen: z.B. Umgang mit Feuer bei einem Kleinkind. Andere werden zum Schutz der Mitmenschen gesetzt: z.B. zum Schutz vor körperlichen oder verbalen Angriffen. An diesen Verboten/ Geboten können Kinder auch Selbstbeherrschung entwickeln, aber auch an schlecht gesetzten Verboten, Phantasien, wie sie zu umgehen sind. Viele Verbote sind nach Korczak einfach überflüssig, wenn der Erzieher genügend voraus planen bzw. die Schüler/ Kinder genügend Vorbereitungszeit auf die Anforderungen erhalten würden.
Kluge & Schnell [6] sehen Korczaks
Verbote und Gebote als "Grenzsetzung im Sinne
der nicht-direktiven Spieltherapie" Sie sind im Grunde
Grenzziehungen gegenüber jedoch skeptisch, da sie immer in der Gefahr
stehen, als Rechtfertigung für unterdrückendes Verhalten zu dienen.
Nur wenn "versagung und Gewährung" zusammen praktiziert würden, wären
die Bedingungen für das kindliche Wachstum günstig. [vergl. 6 S. 142]
Das Wort bestrafung kommt wegen dieser Grundeinstellung bei ihnen überhaupt
nicht vor.
Dagegen meint Korczak zum Strafen : Wenn beim Übertreten der Ordnung bestraft werden muss, dann muss sofort bestraft werden:
Wenn du es aber gleich bestraft hast, so hat es sich über den anderen Tag schon von dem schmerzlichen Erlebnis entfernt und ist der Versöhnung und dem vergessen näher gekommen. Wenn es aber zwei Tage nach einer Strafandrohung morgens erwacht, dann ist vielleicht schon der Augenblick einer schwerwiegenden Abrechnung nahe.
Schauen wir uns jetzt einmal die Art der Strafen bei Korczak etwas näher an:
Es gibt keine Strafen - ich mache dem Kind nur klar, dass es böse gehandelt hat. Es gibt also keine Strafen, sondern nur Tadel, Ermahnung und Zureden. Aber wenn sich darin der Willen zur Herabsetzung verbirgt, .... Manchmal legt ein Kuss schwerere Fesseln auf als die Zuchtrute. Hast du nicht bemerkt, dass man zu einem Kind, wenn es Besserung versprochen hat und es trotzdem etwas anstellt, sehr feinfühlig sein muss? Sonst folgt dem ersten das zweite oder gar das dritte Vergehen nach.
Zärtlichkeiten, Appelle an das Gefühl, ... sind in diesem Sinne keine Erziehungsmittel. In mehreren Beispielen zeigt Korczak, das Kollektivstrafen immer dazu neigen, Unschuldige mit zu treffen. Das einzig erlaubte Erziehungsmittel ist deshalb, sich in die Lage des Kindes hinein zu versetzen, den engen Rahmen von Schuld und Sühne aufzubrechen. Denn, wer Unrecht getan hat, kann dies erkennen und beim nächsten Mal aktiv dagegen angehen.
3.2. Situationen voraussehen und Kinder darauf einstellen:
Korczak bereitete seine Kinder auf neue, vielleicht auch angstauslösende Situationen vor, in dem er ihnen Geschichten erzählte. In diesen Geschichten wurde thematisiert, was passieren könnte und wie man sich dann richtig verhält.
Der Amerikaner Milton H. Erickson ging bei seinen Therapien häufig ganz ähnlich vor. Seine geschichten enthalten das Problem in einer verschlüsselten Form, ein mögliches, erwünschtes Verhalten wird beschrieben. Oft enden die Geschichten mit einer offenen Frage, die seine Klienten von der Aufmerksamkeit auf das Problem ablenkten und auf einen Lösungshorizont verschoben.
Als die Kinder schlafen gingen .... erzählte ich von: .... Einer erwies sich als sehr lieber Kerl, der zweite war immer und mit allem unzufrieden, der dritte hatte sich in den Wochen sehr gebessert, dem vierten passierte etwas sehr Peinliches .... Also nahmen sie ihn in ihren Schutz. Wo mögen diese vier jetzt sein und woran denken sie wohl?Kluge & Schnell [6] verweisen hier auf Gordons Elterntraining: Eltern lernen, wie Kinder auf zukünftige, unbekannte Situationen vorbereitet werden. Kounin und Doyle [in 6] geben als Handlungsstrategie zur Lösung von Störungen des Arbeitsverhaltens folgende Schritte an:
- Den Kindern/Schülern das Ziel der Aufgabe genau mitteilen.
- Ihnen erklären, wo sie anfangen sollen und wie die einzelnen Teilschritte zum Ziel führen.
Literaturhinweise:
[1] Korczak, J. (1989, 9. Auflage):
"Wie man ein Kind lieben soll" Göttingen
[2] Fatzer, G. (1987) : "Ganzheitliches Lernen - Humanistische Pädagogik und Organisationsentwicklung"
Paderborn
[3] Rogers, C. (1976): "Entwicklung der Persönlichkeit" Stuttgart
[4] Schlegel, L. (1988): "Die Transaktionsanalyse"
Tübingen
[5] Watzlawik u.a. (1969): "Menschliche Kommunikation"
Bern
[6] Kluge u.a. (1981): "Eine kindgerechte Umwelt schaffen" München
[7] Grinder, M (1989): "Righting the educational conveyor belt" Portland. (dt. NLP
für Lehrer)
[8] Watzlawik u.a. (1974): Lösungen - Zur Theorie und Praxis menschlichen
Wandels" Bern
- Quellen
- Caselmann:
Wesensformen
- Bollnow:
Tugend d. E. - Spranger: geb.
Erzieher - Winkel: Lehrer-
persönlichkeit - Combe:
Kritik
der Lehrerrolle - Geissler:
Lehrerrolle - Professionalität
- Giesecke: Ende
d. Erziehung - Thalman: Schul-
alltag bestehen - Registerkarte 11
Quellen zu: Der Lehrer als Erzieher
1. Quelle :Johann Amos COMENIUS (1592 - 1670)
Pampaedia (hrsg. und übers. v. J. Tschizewskis, Heidelberg
1960, S. 171) :
„Auf drei Voraussetzungen muß man bei der Wahl des
wahren Lehrers des Ganzen sorgfältig achten :
- Jeder soll so sein, wie seine Schüler werden sollen.
- Er soll die Kunst beherrschen, sie so machen zu können, und
- soll er eifrig am Werke sein.“
....
Zur Erläuterung der ersten Voraussetzung heißt es : „Diese
Menschenbildner (formatores hominum) sollen also besonders erlesene (selectissimi)
Menschen sein... Wie sie wünschen wir uns das Volk der Endzeit : erleuchtet,
friedvoll, gläubig, heilig...“
Zur Erläuterung der zweiten Voraussetzung heißt es : „Um erfolgreich wirken zu können, müssen diese Lehrer
- Alle Aufgaben und Ziele ihres Berufes (vocatio) kennen,
- alle Mittel die dazu nötig sind, und
- die ganze Mannigfaltigkeit der Methoden (methodi).“
2. Quelle: Wilhelm DILTHEY (1833 - 1911):
Grundlinien eines Systems der Pädagogik, Leipzig 1934, S. 201 f.
- „Wir verstehen einen Menschen nur, indem wir mit ihm fühlen...; wir verstehen nur durch die Liebe. Und gerade einem unentwickelten Leben müssen wir uns annähern durch die Kunst der Liebe... Alles Raisonnement tritt nur als sekundär hinzu.“
- „Es ergibt sich also ein zweiter Grundzug, welchen mit dem ersten eng zusammenhängt, daß eine ungebrochene Naivität im Grunde der Seele den Erzieher dem Kinde annähert.“
- „...bemerkt man bei dem pädagogischen Genie ein Sinnen über Seelenleben, das so lebendig, so voll Realitätssinn ist...“
- „Ebenso ursprünglich ist im pädagogischen Genius grübelnde Empfindsamkeit in Bezug auf die Gestaltung der Seele, auf Mitteilung, auf Methode auf Unterricht.“
- „Der Genius ist selten, wie überall, so in der Erziehung.“
- „Auch untergeordnete Köpfe können an der Durchbildung... mitarbeiten; der tüchtige, herzliche, kinderliebe treue Mensch kann... mithelfen, mittun.“
3. Quelle: Georg KERSCHENSTEINER (1854 - 1932):
Die Seele des Erziehers und das Problem der Lehrerbildung, Berlin, 1930, S. 48 f.
- „Der Erzieher ist eine im geistigen Dienste der Gemeinschaft stehende Lebensform des sozialen Grundtypus, der aus reiner Neigung zum werdenden, unmündigen Menschen als einem eigenartigen Träger zeitloser Werte, dessen seelische Gestaltung nach Maßgabe seiner besonderen Bildsamkeit in dauernder Bestimmtheit zu beeinflussen imstande ist und in der Bestätigung dieser Neigung ihre höchste Befriedigung findet.“
4. Quelle: Klaus W. DÖRING:
Lehrerverhalten und Lehrerberuf. Zur Professionalisierung erzieherischen Verhaltens, Weinheim, 1970, S. 10
- „Der ‘privatistischen’ Interpretation von Erzieherverhalten oder ‘Erziehungsstil’ im Sinne einer an der Lehrerindividualität sich einseitig orientierenden Erziehungspraxis wird eine intrumentalistische entgegengesetzt, die sich an der Zweck - Mittel - Korrelation orientiert und Erziehungsverhalten mehr im Sinne von Erziehungstechnik verstanden wissen will. Dahinter steht das Berufsbild eines Lehrers, der sich als Erziehungsspezialist begreift, welcher spezielle Aufgaben mit Hilfe eines differenzierten Instrumentariums pädagogischer Hilfsmittel möglichst optimal zu lösen hat.“
Arbeitsaufgaben:
- Arbeiten Sie innerhalb ihrer Gruppen heraus, welche Vorstellungen die einzelnen Autoren jeweils von der Lehrerpersönlichkeit haben. Bearbeiten Sie dazu nach Absprache zwischen den Gruppen jeweils zwei Texte pro Gruppe und zwar: Nach Wahl eine der Quellen 1, 2, oder 3 und dazu obligatorisch die Quelle 4.
- Überlegen Sie, welche Vorstellungen von Lehrerpersönlichkeit
Sie nach Ihrem eigenen Verständnis einer Erzieherpersönlichkeit
bei den vorgezeigten Quellen mittragen könnten und welche nicht.
Begründen Sie Ihre Auswahl. - Belegen Sie Ihre nach Arbeitsaufgabe 2 getroffene Auswahl durch Beispiele aus Ihrer Praxis.
Christian Caselmann: Wesensformen des Lehrers - Versuch einer Typenlehre
Die Typenmerkmale
Alles Lehrertum, so sagten wir, hat eine sachliche und
eine persönliche
Seite. Der Lehrer muß sich einmal innerlich seinem Bildungsideal ,
dem Lehrziel und dem Lehrinhalt verpflichtet fühlen. Er muß diese
Dinge nicht nur äußerlich beherrschen, er muß in ihnen geistig
und seelisch verwurzelt sein, muß sich verwachsen fühlen mit seinem
Lehrstoff, muß befähigt sein für seine Mission, diese Kulturinhalte
der jungen Generation nahezubringen, daß auch sie diese Werte ergreife
und von ihnen ergriffen wird. Sehr viele Lehrer schlagen die Lehrerlaufbahn
ein, weil sie schon als werdende junge Menschen innerlich von den Werten
der Kultur begeistert sind, weil sie lebenslang mit diesen Dingen umgehen
wollen. Die Mehrzahl der Lehrer an den höheren Schulen wird zu dieser
Gruppe gehören, aber auch ein großer Prozentsatz der Volksschullehrer
zählt zu ihr. Wie viele Bauern- und Handwerkersöhne, die hervorragende
Lehrergestalten geworden sind, haben diesen Beruf ergriffen oder sind von
ihren Lehrern dazu ausgesucht und bestimmt worden, nur weil sie als Schulbuben
eine besondere Fähigkeit und ein den Durchschnitt überragendes
Interesse an den Gegenständen des Unterrichts zeigten!
Wissens- und Wissenschaftsdrang zeichnet diese jungen Menschen vor anderen
aus. Wir nennen diese Typengruppe logotrop, d.h. der Wissenschaft,
der Kultur zugewendet. Den logotropen Lehrern geht es in erster Linie um
Bildungsideal und Bildungsziel, um positives Wissen und Können , um
den Lehrstoff, um die Weckung der Begeisterung bei der Jugend für die
Kulturwerte. Bei aller Unterrichts- und Erziehertätigkeit liegt für
sie das Schwergewicht, der Hauptakzent, auf den objektiven Werten, an denen
die jungen Menschen sich emporbilden sollen. Diese Kulturwerte sind also
Ausgangspunkt und Zielpunkt ihres Lehrertums.
Bei genauerem Zusehen zerfällt die Gruppe der Logotropen in zwei Untergruppen: in
die philosophisch Interessierten und in die fachwissenschaftlich Interessierten.
Für die philosophisch Interessierten ist die von ihnen ergriffene Wissenschaft
in erster Linie Baumaterial für die eigene Lebens- und Weltanschauung.
Es geht ihnen schließlich immer um die letzten Wahrheiten, um Gott
und Welt, um Sein und Schein , um Gesetz und Freiheit, um Ich und Gemeinschaft. An
diese Fragen wollen sie auch letztlich ihre Schüler heranführen,
und wenn sie das nicht können wegen des noch zu unreifen Alters der
Schüler, dann ist doch ihr ganzer Unterricht aus philosophischen Grundüberzeugungen
gespeist und von ihnen durchwaltet. ...
Ihr Unterricht wird sich stets durch eine gewisse wohltätige Geschlossenheit
auszeichnen und daher oft große Wirkung haben.
Beispiele (siehe Vorwort) mögen das veranschaulichen.
„Seine Gesichtszüge sind fast dauernd straff angespannt, als ob er immerzu denke oder grüble. Die griechische Philosophie hat es ihm angetan, und sie beschäftigt ihn auf Schritt und Tritt. Immer wieder setzt er sich mit ihr und der christlichen Ethik auseinander, und es ist schwer zu entscheiden, welche der beiden Denkarten ihn mehr zu dem gemacht hat, was er ist. Wie von sich verlangt er auch von seinen Schülern unbedingte Selbstzucht. Das fängt schon beim Lesen des lateinischen oder griechischen Textes an. Auch nicht ein unbedeutend scheinendes Wörtchen darf beim Übersetzen außer acht gelassen werden. ‘Es ist eine Frage der Ehrfurcht’, pflegt er dabei zu sagen. So will er Grundlagen schaffen, auf denen später weitergebaut werden kann.“
In ihrem Fach möchten sie bis an die Grenzen des Wissens schreiten,
alles ist ihnen wichtig und interessant. Sie imponieren als Lehrer der Jugend
durch ihr Können und Wissen und reißen sie durch ihre Begeisterung
für die Gegenstände des Unterrichts mit fort. Wenn sie auch nicht
so ins Grundsätzlich-Philosophische gehen und nicht so in die Tiefe
graben, so lernt man doch bei ihnen viel und leicht; sie erzielen daher erstaunliche
Unterrichtserfolge. Wie von den philosophisch Interessierten geht auch von
ihnen eine Begeisterung für die von ihnen vertretenen Fächern aus.
Sie haben keinen so unmittelbaren persönlichen erzieherischen Einfluß;
aber ihre unterrichtliche Wirkung ist vielleicht dafür größer,
und indirekt wirken sie so durch die den Stoffen innewohnenden Bildungselemente
doch auch in nicht geringem Maß erzieherisch. Man findet bei ihnen
nicht nur überwiegend Naturwissenschaftler, sondern auch Geographen,
Historiker und Neussprachler. Wirkten die philosophisch Interessierten durch
ihre Geschlossenheit, so fesseln die fachlich Interessierten durch die Vielseitigkeit.
Sie, die in der ganzen Weite ihres Faches zu Hause sind, zeigen immer wieder
neue, unbekannte Seiten, beleuchten ihren Gegenstand von den verschiedensten
Punkten. Sie sind im allgemeinen der Außenwelt mehr zugewendet als
die philosophisch Interessierten.
Sie verlassen sich daher nicht nur auf die magnetisch wirkende Kraft ihres
Stoffes, sondern werben für ihn; so sind sie oft auch von ihrem Stoff
her methodisch interessiert. Sie machen mit ihren Schülern Schulausflüge,
opfern für Arbeitsgemeinschaften, Besuche von Museen, Galerien und dergleichen
ihre freie Zeit, sie ziehen einzelne Schüler oder Schülergruppen
zur Mitarbeit in Laboratorien und auf wissenschaftlichen Exkursionen (beim
Botanisieren, Raupen-, Käfersammeln und dergl.) heran; sie helfen ihnen
Herbarien oder andere Sammlungen anlegen, nehmen sie auf Spaziergänge
mit und lehren sie die Vogelstimmen und Pflanzen kennen. Das alles tun sie
aber nicht so sehr aus Liebe zur Jugend wie aus der Erfülltheit und
Begeisterung für ihre Sache. Ihr großes Wissen und ihr Aufgehen
in ihrem Fach imponiert der Jugend und reißt sie mit.
Dem logotropen Flügel, der die sachliche Seite des Lehrertums vertritt,
steht nun der paidotrope Flügel, der das persönliche Element darstellt,
gegenüber. Paidotrop, d.h. dem Kinde zugewandt, sind
diejenigen Lehrer, die in erster Linie nicht an den Stoff, sondern an das
Kind denken. Von vornherein, anlagemäßig, lockte sie weniger die
Wissenschaft als die Tätigkeit des Erziehens und Unterrichtens. Der
Umgang mit jungen Menschen ist ihnen ebenso Herzensbedürfnis wie den
Logotropen die Beschäftigung mit der Wissenschaft. In ihnen ist nicht
der wissenschaftliche, sondern der eigentlich pädagogische Eros lebendig.
Während die logotropen Lehrer sich für unterrichtliche Fragen,
sei es, daß es sich um die Stoffauswahl oder um methodische Probleme
handelt, immer vorzugsweise unter dem Gesichtspunkt des Stoffes interessieren,
kommen die paidotropen Lehrer an all diese Unterrichtsfragen vom Blickwinkel
des Kindes aus heran. Die Logotropen wollen in erster Linie in der Schule
unterrichten, den Paidotropen ist es vor allem um Erziehung zu tun. Wenn
bei den Paidotropen wissenschaftliches Interesse lebendig wird, wendet es
sich in erster Linie jugendpsychologischen Fragen zu.
Auch bei den Paidotropen finden wir zwei Untergruppen: die individuell-psychologisch
Interessierten und die generell-psychologisch Interessierten.
Die erste Gruppe, die der individuell-psychologisch Interessierten, wendet
sich in erster Linie dem einzelnen Schüler zu. Diese Lehrer wollen jeden
Schüler möglichst genau kennen und verstehen lernen. Sie bemühen
sich, jeden Schüler mit all seinen Fehlern und Schwächen liebend
zu umfassen, seiner Individualität gerecht zu werden, sein persönliches
Vertrauen zu gewinnen und so den erzieherischen Ansatzpunkt zu finden, der
die Voraussetzung für die unterrichtliche Arbeit und ihren Erfolg ist.
„Es war nicht so sehr ihr Unterricht, der uns fesselte, als ihre Persönlichkeit.
In ihrer Art lag das Mütterliche. Jedes konnte mit ihr sprechen, sie hatte
Zeit für jedes. Ihre Ratschläge kamen immer aus dem Herzen. Sie nahm
uns als Menschen, jeden nach seiner Eigenart und Veranlagung. Sie sprach selten
vor den andern etwas, das Bezug auf unser persönliches Leben und unsere
Zukunft hatte, aber trotzdem spürten wir ihre Anteilnahme und ihre Verbundenheit
mit uns. Sie hat manchem über eine schwere Krise hinweggeholfen einfach
dadurch, daß sie es in seiner Art zu verstehen suchte.“
Arbeitsauftrag:
- Fassen Sie die Vorstellungen Caselmanns von den Wesensformen des Lehrers, wie sie in diesem Textauszug sichtbar werden, zusammen, stellen Sie sie dem Plenum in geeigneter Form vor und beleuchten Sie sie kritisch.
- Finden Sie sich selbst oder andere Pädagogen, die Sie (vielleicht aus Ihrer Schulzeit oder Ihrem derzeitigen Kollegium) kennen, zutreffend in ihrer Wesensform durch Caselmann beschrieben?
- Typisierungen, wie die Caselmanns, lassen einen schnell an „Schubladen“ denken; doch obwohl Caselmanns Darlegungen schon recht lange zurückliegen, können wir doch noch heute bestimmte (moderner gewandete) Archetypen wiedererkennen. Haben „Schubladen“ doch etwas für sich?
Otto Friedrich Bollnow: Über die Tugend des Erziehers
Über die Tugenden des Erziehers zu sprechen ist heute ein gewagtes
Unternehmen. Man setzt sich dabei dem Verdacht aus, vor einer nüchternen
wissenschaftlichen Behandlung des Erziehungsvorgangs in eine billige
moralisierende Betrachtungsweise zurückzuweichen, die wir durch
die Ausbildung einer empirischen Erziehungswissenschaft endlich überwunden
zu haben glaubten. Schon das bloße Wort „Tugend“ ist
heute nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch im alltäglichen
Sprachgebrauch verdächtig geworden. Es klingt nach einer ängstlichen
Anpassung an die Forderungen der herrschenden Moral, nach der Haltung
eines bloßen Musterschülers; der sich nicht aufzulehnen wagt
und sich widerspruchlos allen Anforderungen seiner Umwelt fügt.
Tugendhaftigkeit scheint mehr in einem Verzicht als in der Äußerung
eines kraftvoll sich entfaltenden Lebens zu liegen. War noch vor 100
Jahren die Tugendhaftigkeit die Auszeichnung eines wohlgeratenen jungen
Menschen, so wird sich die heutige Jugend nicht gerne als tugendhaft
bezeichnen lassen. Von einem tugendhaften Lehrer oder Erzieher zu sprechen
ist heute nahezu unmöglich. Es würde gleich die Vorstellung
von Untertanengeist und mangelnder Zuvilcourage erwecken.
Und dennoch darf man bei aller wissenschaftlichen Behandlung des Erziehungs-
und Unterrichtsvorgangs nicht vergessen, dass es letztendlich der Mensch
ist, die in ihrer vollen Menschlichkeit überzeugende Persönlichkeit,
die im Kind erst die Erziehungsbereitschaft hervorruft und ohne die alle
Erziehungsbemühungen wirkungslos bliebe …
Ich möchte nun drei Tugenden herausgreifen, die mir beim Erzieher
für das Gelingen seiner Bemühungen besonders wichtig zu sein
scheinen: die erzieherische Liebe, die Geduld und das Vertrauen.
I.
Die erste erzieherische Tugend ist die Liebe. Sie allein gibt dem auf
die Veränderung der seelischen Struktur des zu Erziehenden gerichteten
Tun einen warmen menschlichen Ton und macht überhaupt erst den
Eingriff in die Persönlichkeit des Kindes, so sehr dieser sachlich
berechtigt und gefordert sein mag, für das Kind erträglich.
Aber mit dem Wort Liebe ist zu wenig gesagt. Es ist eine Liebe besonderer
Art, die wir in ihrer Besonderheit erfassen müssen.
a.) Man hat seit alters her gern von einem pädagogischen
Eros gesprochen und damit auf die tiefsinnige Liebe Platons verwiesen:
die Liebe zur schönen Seele im schönen Leib des Knaben, die
sich dann zur Liebe zum Schönen überhaupt erhebt. Und sicher
ist damit, wenn wir von der Besonderheit der griechischen Knabenliebe
absehen, etwas Wesentliches getroffen: der eigentümlich ästhetische,
frohgemute, ich möchte sagen: frühlingshafte Zug in der erzieherischen
Zuwendung. Wir freuen uns an dieser Freude des Erziehers an seinem Tun.
Viele sind erst dadurch zu Erziehern geworden.
Trotzdem liegt in dieser Erotisierung der Erziehung, auch wenn sie noch
so vergeistigt verstanden wird, eine Gefahr. Auf jeden Fall trifft sie
nicht den Kern des erzieherischen Verhältnisses, und es ist wichtig,
sich den Unterschied klar zu machen. Max Scheler hat
in seinem Buch „Wesen und Form der Sympathie“ in überzeugender
Weise herausgearbeitet, wie die Liebe nicht etwa blind macht, wie eine
verbreitete Redensart sagt, sondern im Gegenteil die Augen öffnet
für die in einem Menschen vorhandene Wertqualitäten. Die Liebe
ist bewundernd, aufschauend, nicht umsonst spricht man in der Umgangssprache
von einer Angebeteten und einem Anbeter. Auf jeden Fall: der Liebende
liebt den Menschen so, wie er ist, in der ihm erscheinenden Vollkommenheit.
Er kann gar nicht auf den Gedanken kommen, an dem geliebten andern
Menschen etwas verändern zu wollen. Zusammengefasst. die erotisch
verstandene Liebe schließt die Absicht, etwas verändern zu
wollen, und damit die pädagogische Absicht aus, und wo sie auftritt,
wird sie vom Geliebten als Verrat empfunden. Das gilt auch vom Verhalten
zum Kind. Die ästhetisch geprägte Liebe freut sich an der Vollkommenheit
des Kindes, und zwar gerade so, wie es jetzt ist, in diesem Stadium seiner
Entwicklung. Sie kann höchstens nur mit Wehmut daran denken, wie
bald die Entwicklung darüber hinausgeht und die jetzige Schönheit
wieder zerstört. Sie fragt vielleicht in tiefer Resignation, warum
aus so glücklichen, schönen Kindern so abscheuliche Erwachsene
werden.
Noch einmal: die erotische Liebe nimmt den Menschen so, wie er ist. Fehler
an ihm erkennen zu müssen, ist schmerzlich, und solche Fehler verbessern
zu wollen, also erziehen zu wollen, ist Versündigung am Geist der
Liebe. Ein Erziehungsversuch zerstört die Liebe, der er doch in
guter Absicht dienen wollte, und diese Wirkung ist oft nicht wieder rückgängig
zu machen. Das ist vielleicht eine der schmerzhaftesten Erfahrungen,
die der liebende Mensch machen kann.
b.) Aber nicht alle Liebe ist Eros. Es gibt noch eine ganz andere Liebe, nämlich die sich hinabneigende Liebe zum notleidenden und geschundenen andern Menschen, die in Ehrfurcht vor dem Leiden hinabsehende Liebe, die aus dem Mitleid und sich im Willen zur Hilfe zur Linderung der Not auswirkt. Während die erste Form dem antiken Kulturkreis entsprungen ist, gehört die zweite der christlichen Überlieferung an. Es ist die agape, die caritas. Auch sie hat sich als wesentlicher Faktor in der Erziehung ausgewirkt, als besondere Hinwendung zu den Armen und Unterdrückten, zu den geistig und körperlich Behinderten. Pestalozzi mag mit seiner Armenerziehung als großes Beispiel dastehen. Mönchsorden und Kongregationen haben schon im Mittelalter Bewunderswertes geschaffen, und in der heutigen Sozialpädagogik ist sie wieder lebendig. Man könnte mit einigem Recht den unter deprimierenden Bedingungen arbeitenden Sonderschullehrer als Heiligen unserer Tage bezeichnen. Der Pädagoge fühlt sich in innerster Seele den vom Leben Benachteiligten verbunden und empfindet in sich Streben, die Ungerechtigkeit ihres Schicksals, soweit es in seinen Kräften steht, auszugleichen.
c.) Und trotzdem ist die aus der caritas entsprungene
Hilfe noch kein eigentlich erzieherisches Verhalten. Sie will dem anderen
Menschen in seiner Not beistehen, indem sie seine Umstände verändert. Ihn
selbst aber will sie nicht verändern (oder höchstens so weit,
dass er imstande ist, sich mit seinen widrigen Umständen besser
abzufinden). Erziehung aber will den Menschen verändern. Wenn man
auch die Erziehung eigentlich nicht ganz unverständlich als Lebenshilfe
bezeichnet hat, so ist das doch eine Hilfe ganz besonderer Art, nämlich
eine solche, die nie die Umstände, sondern den Menschen selbst betrifft.
Die erzieherische Hilfe will, ganz banal ausgedrückt, dem
Kind oder allgemein ausgedrückt, dem anderen Menschen helfen, eine
neue Stufe seiner Entwicklung zu erreichen. Insofern ist auch die richtig
verstandene Psychotherapie nicht nur Herstellung, d.h. Wiederherstellung
eines durch Krankheit verloren gegangenen gesunden Zustandes, sondern
zugleich Erziehung, d.h. Hilfe bei der Erreichung eines neuen Reifezustandes.
Es wäre wohl an der Zeit das Verhältnis von Pädagogik
und Psychotherapie einmal grundsätzlich zu durchdenken. Im Sinne
der Rechtfertigung auf die zu erreichenden Stufen hat Spranger
immer wieder die erzieherische Haltung beschrieben. Der Erzieher sieht
im Kind die in ihm angelegten Wertmöglichkeiten nicht, wie bei Scheler,
die schon vorhandenen Werte, sondern die noch schlummernden Wertmöglichkeiten,
und diesen will er durch sein Tun zur Entfaltung helfen.
Und trotzdem ist diese Bestimmung ein wenig zu schön. Sie übersieht
die leidvollen Erfahrungen, die jeder Erzieher macht: dass es im Kinde
nicht nur die idealen Möglichkeiten gibt, die es zu entfalten gilt,
sondern auch die Bosheit und die Schwäche, die die Entwicklung behindern
und verkehren. Der Erzieher – und mit ihm die pädagogische
Theorie – darf hierfür nicht blind sein. Er muss mit seiner
Liebe und seinem Blick für die schlummernden idealen Möglichkeiten
zugleich das Kind ganz realistisch sehen: mit all seinen Schwächen
und Gebrechen, die all seine Erziehung immer wieder in Frage stellen.
Mein verehrter Lehrer Herman Nohl hat immer
wieder betont, dass erst die Verbindung von idealistischem und
realistischem Blick das Wesen des erzieherischen Verhältnisses ausmacht.
Und diese Doppelheit bestimmt auch das Wesen der erzieherischen Liebe,
in der mehr Komponenten vereinigt sind: die naive Liebe zum Kind, besonders
zum kleinen Kind in seiner rührenden Hilflosigkeit, die eine aufbauende
Arbeit anregende Liebe zu dem im Kind schlummernde Möglichkeiten
und die teilnehmende geduldige Liebe ( ich will nicht sagen zu seinen
Schwächen, aber) in all seinen Schwächen.
Aber pädagogisch ist sie nur, wenn sie kein weichliches Nachgeben
gegenüber den leider nun einmal vorhandenen Schwächen ist,
sondern bei aller Nachsicht den erzieherischen Anspruch unbeirrt aufrecht
erhält, wenn sie in aller Milde zugleich streng ist und nur in dieser
Strenge das Kind wirklich ernst nimmt. Sie bewegt sich also in der schwer
zu gewinnenden Mitte zwischen verständnisvoller Nachsicht und sittlicher
Forderung. Weil diese Mitte aber schwer einzuhalten ist, weil sie vom
Erzieher die Zurückhaltung seines unmittelbaren Formungswillens
fordert, darum ist diese Liebe nicht einfach Naturanlage eines „geborenen
Erziehers“, sondern wie Spranger es in eindringlicher Warnung vor
diesem irreführenden Begriff hervorgehoben hat, eine Tugend, die
erst in strenger Selbsterziehung in immer neu geübter Geduld und
Zurückhaltung erworben werden muss. „Der Erzieher“,
sagt Spranger: „wird geboren aus Selbsterziehung“.
2.
Damit sind wir unversehens zu der zweiten großen Erziehertugend
gekommen, der Geduld. Zwar ist die Geduld eine allgemein von Menschen
geforderte Tugend und nicht auf den Erzieher beschränkt, aber sie
betrifft den Erzieher in einer ganz besonderen Weise. Aber ehe wir auf
das besondere Problem der vom Erzieher geforderten Geduld eingehen, ist
es zweckmäßig, einige allgemeine Erwägungen über
das Wesen der geduld vorauszuschicken und etwas nachholen, was ich in
früheren Arbeiten nicht voll genug gesagt habe. Die Geduld betrifft
auf der einen Seite das Verhältnis des Menschen zur Zeit. Sie ist
die Kunst des Abwarten-Könnens. Sie ist darum so schwer zu erlernen,
weil der Mensch die natürliche Neigung hat, den Ereignissen, insbesondere
den erfreulichen, in Gedanken vorauszueilen, ihr eintreten nicht abwarten
zu können. Er verzehrt sich dann in seiner Ungeduld und Vernachlässigt
die Forderungen des Augenblicks. Die Geduld ist demgegenüber die
Fähigkeit des Warten-Könnens, bis der richtige Zeitpunkt gekommen
ist, als die Fähigkeit, die natürliche Ungeduld zu beherrschen.
Darin kommt der eigentliche Tugend-Charakter zum Ausdruck: Im Unterschied
zu anderen, sich von innen heraus entwickelnden, sozusagen natürlichen
Tugenden wie Mut, Tapferkeit usw. muss die Geduld erst durch Selbstdisziplin
der natürlichen Neigung abgewonnen werden.
Darin kommt zugleich die andere Seite der Geduld zum Ausdruck. Geduld hängt sprachlich mit dulden zusammen (wenn das Wort auch nicht aus dem Verbum abgeleitet ist, sondern das Verbum erst aus dem Substantiv Geduld). Man spricht von einem in Geduld ertragenden Leiden , Geduld bezeichnet das freiwillige Hinnehmen von Widerwärtigkeiten, das Erleiden also das Sicheinfügen in das Unvermeidbare mit all seiner Bitterkeit. Es ist eine Tugend der Passivität. Aber auch diese Seite der Geduld fasst sich unter einem bestimmten zeitlichen Aspekt. Geduldig ist noch nicht das Hinnehmen eines Schicksalsschlags, einer Niederlage oder eines schweren Verlusts, sondern geduldig ist der Mensch erst in der Dauerbelastung, etwa eine lang währende Krankheit. Den Schicksalsschlag nimmt man hin und setzt sich mit ihm ehrlich auseinander, und damit ist die Angelegenheit abgetan. Geduld aber übt man bei einer lang andauernden Belastung. Sie ist so schwer zu erlernen, weil man sie immer neu aufbringen muss.
Vor diesem doppelten Hintergrund muss man aber auch die Geduld des Erziehers sehen. Sie ist auf der einen Seite die Kunst des Wartens-Könnens und in sofern die Geduld des Gärtners oder des Landmannes, die das Wachstum von sich aus nicht beschleunigen können, sonder warten müssen, bis die Ernte reif geworden ist. Das gilt auch für den Erzieher, soweit man sein Geschäft als ein Wachsen-lassen betrachten kann. Aber gerade weil der Erzieher die schlummernden Möglichkeiten im Kinde sieht, hat er das natürliche Verlangen, sie auch verwirklicht zu sehen und die Entwicklung so schnell wie möglich voranzutreiben. Die Mutter freut sich über alles, was ihr Kind „schon kann“, und ist geneigt, in ihrer Freude darin gleich ein Wunderkind zu sehen. Der Lehrer freut sich an den Lernfortschritten seiner Klasse und wird ungeduldig, wenn sich einige Nachzügler melden, die etwas immer noch nicht verstanden haben. Daher die Tendenz zur Verfrühung als die spezifische Gefahr der Pädagogik. Und demgegenüber bedeutet die Geduld die Disziplinierung des natürlichen Strebens, der Zeit vorauseilen zu wollen, das richtige Sich-einfügen in den natürlichen Lauf der Zeit. (Wenn ich also von einem Sich-einfügen spreche, so ist damit zugleich gesagt, dass man nicht nur vorauseilen, sondern auch nicht hinter dem, „was in der Zeit ist“, aus schuld oder Schwäche zurückbleiben darf. Geduld ist also alles andere als bloße Nachlässigkeit).
Aber wenn man sagt, dass der Erzieher mit seinen Kindern Geduld haben muss, so hat das noch einen anderen Sinn- Er muss Geduld haben mit ihren Schwächen, Geduld mit ihren Unarten und Bosheiten, geduld vor allem, wenn sie immer wieder rückfällig werden, auch wenn sie mit ehrlichem Herzen Besserung versprochen haben. Geduld fordert das Vorgehen können und die Kraft zu einem neuen Anfang. Und wenn man im Evangelium auf die Frage, ob es genüge, sieben mal zu vergeben, die Antwort gegeben wird: nein, sondern sieben mal siebzig- mal, ist damit die schwere Aufgabe des Erziehers bezeichnet : immer wieder verzeihen und verstehen müssen, um nach allen Enttäuschungen mit neuem Vertrauen wieder anfangen zu können. Das geht oft an die Grenzen des Menschenmöglichen, und das kann der Erzieher nur leisten, wenn er über alle Rückschläge hinaus das feste Vertrauen hat, dass auf die Dauer seine geduldige Arbeit nicht vergebens ist.
3.
Damit sind wir bei der dritten Grundtugend des Erziehers: dem Vertrauen.
Es ist heute allgemein bekannt, wie wichtig es für ein Kind und
besonders für ein kleines Kind ist, dass es in einer Welt aufwächst,
in der es sich geborgen fühlt, insbesondere dass es sich mit einem
bestimmten anderen Menschen verbunden fühlt, der ihm diese Geborgenheit
vermittelt, weil es zu ihm ein uneingeschränktes Vertrauen hat.
In der Regel ist es im ersten Lebensjahr bekanntlich die Mutter. Ich
kann mich nicht enthalten, hier das Wort des mir befreundeten, allzu
früh verstorbenen Kinderarztes Alfred Nitschke anzuführen. „Die
Mutter“ so schreibt er in seinem schönen Buch über
den Menschen als „das verwaiste Kind der Natur“, auf das
ich noch einmal nachdrücklich hinweisen möchte. „Die
Mutter schafft mit ihrer sorgenden Liebe für das Kind den Raum
des Vertrauenswürdigen, Verlässlichen, Klaren. Was in ihm
einbezogen ist, wird zugehörig, sinnvoll, lebendig, vertraut,
nahe und zugänglich. Daher stammen die Kräfte der Einsicht,
die dem Kind den Zugang zur Welt, zu den Menschen und zu den Dingen
ermöglichen“. Also: auch das Verständnis der Welt im
Ganzen wird dem Kind erst durch den Bezug zu einem bestimmten einzelnen
Menschen vermittelt. Daher ist der ungeheure Schaden, der entsteht,
wenn ein solcher vertrauenswürdiger Mensch nicht vorhanden ist.
Das ist heute bekannt und durch die Untersuchungen von Spitz vielfach
bestätigt.
Sehr viel weniger wird die Wichtigkeit des in entgegen gesetzter Richtung verlaufenden Vertrauens beachtet, des von seiner Umgebung, insbesondere seinem Erzieher, dem Kind entgegengebrachte Vertrauens, des Vertrauens also, das nicht das Kind seiner Umgebung entgegenbringt, sondern das ihm von seiner Umgebung entgegengebracht wird. Und trotzdem gilt auch hier, dass das Kind ohne ein solches ihm von der Umgebung entgegengebrachten Vertrauens sich nicht richtig entwickeln kann und darum durch den Entzug dieses Vertrauens in seiner Entwicklung schwer geschädigt wird.
Das wird vielleicht am durchsichtigsten im Falle des Versprechens. Ich kann einem anderen Menschen nur etwas versprechen, wenn dieser andere Mensch auch bereit ist, mein Versprechen anzunehmen, und das heißt, dass dieser auch davon überzeugt ist, dass ich meine Versprechen halten kann und halten werde. Verweigert er die Annahme des Versprechens, erklärt er etwa skeptisch oder spöttisch überlegen, dass ich es doch nicht halten werde, weil es mir dazu an Kraft oder gutem Wille fehlt, so entzieht er mir dadurch die Kraft, dies Versprechen zu halten, und bringt gerade das hervor, was er befürchtet hatte. Es gibt keine Treue in den leeren Raum. (Dagegen darf man nicht einwenden, dass es auch Versprechen gibt, die man sich selbst gibt. Das ist ein sehr nachlässiger Sprachgebrauch. Sich selbst gegebene versprechen gibt es nicht. Das sind höchstens gute Vorsätze. Und das ist etwas ganz anderes. Versprechen kann man nur einem anderen geben. Sie bleiben immer vom Vertrauen anderer abhängig. Das ist für die Erziehung von allergrößter Bedeutung. Nur wo ich dem Kind etwas zutraue, traut es auch sich selbst etwas zu ….)
Das kann man noch etwas allgemeiner fassen: Das Kind formt sich unbewusst nach dem Bild, dass sich der Erzieher von ihm macht. Es wird wirklich so, wie der Erzieher es von ihm erwartet. Wenn es der Erzieher für ehrlich, ordentlich, fleißig, zuverlässig usw. hält, dann werden eben dadurch die entsprechenden Eigenschaften beim Kinde geweckt. Und umgekehrt, wo der Erzieher im Kinde nur immer das Schlechte argwöhnt, da wird das schlechte durch den Argwohn geradezu hervorgerufen, und das Kind wird wirklich so dumm und faul und verlogen, wie es der Erzieher von ihm erwartet hatte. Das belastet den Erzieher mit einer ungeheuren Verantwortung, denn sein Urteil über das Kind ist nicht seine Privatangelegenheit, sondern wirkt sich unmittelbar auf die kindliche Entwicklung aus …
Das ist für die Erziehung von ungeheurer Bedeutung: Nur wo der Erzieher wirklich an ein Kind glaubt, wo er Vertrauen zu ihm hat, kann sich das Kind entwickeln. Die Frage aber ist: Woher nimmt der Erzieher die Kraft zu diesem Vertrauen? Denn die Wirkung dieses Vertrauens geschieht nicht in der Art eines zwangsläufigen Naturgesetzes. Sie kann auch ausbleiben, und sie bleibt auch häufig aus. Immer wieder wird der Erzieher enttäuscht. Immer wieder bleibt das Kind hinter den Erwartungen zurück. Immer wieder stößt der Erzieher auf Schwäche und Bosheit. Immer wieder scheitert er bei seinen gut gemeinten versuchen. Das Scheitern gehört wohl wie in keinem anderen Beruf zur Arbeit des Erziehers. Es wäre Feigheit, das nicht sehen zu wollen. Und hier setzt die eigentümliche Schwierigkeit des Erziehers ein: trotz aller bitteren Enttäuschungen, trotz aller so genannten Erfahrungen das Vertrauen wieder aufbringen zu müssen …
Das gelingt ihm nicht aus eigener Kraft auf bloßen Vorsatz hin. Das ist nur möglich, wenn sich der Erzieher seinerseits von einem anderen und tiefen Vertrauen getragen ist, von einem Vertrauen darauf, dass trotz aller Rückschläge und Misserfolge sein Tun einen Sinn hat. ….
nach obenEduard Spranger: Der geborene Erzieher
Gegen die Fassung des Titels dieser Schrift können Bedenken erhoben
werden; sie sind im Text berücksichtigt.
Ich glaube, im deutschen Schulleben unserer Tage gewisse Klimaveränderungen
zu bemerken , die nach der Seite der Trockenheit hingehen. Aus der Sorge
heraus, daß die Austrocknung zu groß werden könnte ,
habe ich vor zwei Jahren das kleine Heft „Der Eigengeist
der Volksschule“ veröffentlicht. Hier folgt eine zweite Herzensergießung.
Sollte es trotz meines hohen Alters noch so weiter gehen, käme vielleicht
eine Schriftenreihe zustande, der ich die Sammelbezeichnung geben würde: „Mehr
Freude an der Schule!“
Die vorliegende Schrift ist aus einem Vortrag entstanden, den ich im
Frühjahr 1956 bei der Entlassungsfeier der Studenten des Pädagogischen
Instituts in Weingarten gehalten habe.
Hier soll nur von einem Beruf die Rede sein, der völlig seinen Sinn verliert, wenn er nicht mit der „Leidenschaft des Geistes“ ergriffen wird, nämlich von dem des Erziehers, in den der des Lehrers wesensmäßig miteingeschlossen ist.
Wenn man heute vom „Wehen des Geistes“ redet, gerät man in den Verdacht, aus einer versunkenen Zeit zu stammen, in der man noch mit Pathos etwas ausrichten konnte. Man muß sich daher auf Fälle zurückziehen, in denen es wirklich ohne „Inspiration“ nicht geht. Bei dem schöpferischen Künstler redet man ausdrücklich vom „Genie“. Man bedient sich dann nur des lateinischen Wortes genius für das Besessensein von einem Daimon. Jeder denkt dabei sogleich an das Daimonion, dessen Stimme Sokrates in sich zu hören behauptet hat. Was er damit eigentlich gemeint hat, ist immer noch strittig. Es gibt wirklich sehr verschiedene Geister, die durch Menschen hindurch wirken können. Auch dies wäre ein interessantes Unternehmen, zu studieren, welche Dämonen in unserer Zeit der „Entmythologisierung“ etwa übrig geblieben sind. Später wird sich herausstellen, daß der „Geist der Erziehung“ von dem des künstlerischen Schaffens grundsätzlich verschieden ist. Kein Zweifel aber, daß es auch so etwas gibt, wie pädagogische Genialität.
Es gibt keinen Beruf, zu dem man weniger „geboren“ sein könnte, als den des Erziehers. Denn zu seinem Wesen gehört eine beträchtliche Reife. Wenn es aber eine Art von innerem Vorgeformtsein auch für geistige Leistungen gibt, zu deren Entfaltung ein langer Bildungsweg nötig ist, so kann man wohl in einem übertragenen Sinne vom „geborenen Erzieher“ sprechen. Die Bezeichnung ist dann ein Ausweichen vor dem Fremdwort „der .......... Erzieher“, meint aber das Gleiche, nämlich den Pädagogen von so echter Art, „als ob“ er für das Erziehertum geradezu geboren wäre. Wir sagen ja auch: „der geborene Feldherr“, und doch kann niemand zum Feldherrn, geschweige dann „als Feldherr“ im wörtlichen Sinne geboren werden.
Im Grunde zielt dieses Bemühen auf immer neue Umschmelzungen des
Inneren. Man denke an den Knopfgießer in Ibsens „Peer Gynt“!
Wo geschmolzen werden soll, ist ein Feuer nötig. Ohne Bild: nur
in der Temperatur der Liebe gelingt es, Menschen in ihrem Kern zu beeinflussen.
Ihre Wärme durchwaltet das ganze Gemüt und strahlt aus auf
die Begegnung von Erzieher und Zögling. Das haben wir oft gelesen,
besonders bei Pestalozzi; ebenso bei Kerschensteiner. Aber man glaube
nicht, daß mit diesem Zauberwort das letzte Rätsel gelöst
sei. Vielmehr fängt nun das Gebiet erst an, auf dem der geborene
Erzieher seine Kraft entfalten muß.
Liebe ist ein vieldeutiges Wort. Es gilt, diejenige Art ins Spiel zu
setzen, die dem Geist der Erziehung gemäß ist. Es kommt auch
darauf an, ihre Temperatur richtig zu temperieren. Darüber gibt
es kein Vorschriftenbuch.Vielmehr ist es eben der geborene Erzieher,
der hier aus einem tiefen geistigen Instinkt heraus das Richtige trifft.
Die anderen mögen ihm zusehen und ihm ein wenig von dieser Kunst
ablernen. In Autobiographien finden wir Gestalten von Müttern, die
schon die Natur mit einer wunderbaren Liebesfülle ausgestattet hat.
Noch lehrreicher aber sind wohl die Bilder von Vätern, deren ernste
Lebensführung von einer verhaltenen Liebe durchdrungen ist. Sie
läßt sich immer finden, wenn es not tut. Aber sie strömt
nicht einfach; sie stellt ihre Bedingungen, und erst deshalb ist sie
für den Bildsamen eine bildende Liebe.
Bei der didaktischen Bearbeitung des Objektes muß aber auch der Entwicklungsstufe des Subjektes, nämlich des zu Bildenden, Rechnung getragen werden. Jedes Lebensalter hat seine eigentümliche Seelenstruktur. Von ihr her bestimmt sich die Aneigungsfähigkeit und Aneignungsweise. Dem geborenen Erzieher verwandelt sich sein Bildungsgut, obwohl es seinerseits eindeutige Forderungen an den Aufnehmenden stellt, unter der Hand doch ganz von selbst, je nachdem ob es sich an das magische Alter oder an das folgende, für das wir keinen übergeschlechtlichen Namen haben, oder an das Reifungsalter wendet. Ein und dieselbe Geschichte z.B. muß da ganz verschieden erzählt werden.
Es wäre für den Anfänger lehrreich, solche „didaktischen
Variationen“ über ein Thema einmal fixiert vor Augen zu haben.
Allgemein gilt: Der geborene Lehrer und Erzieher ist unablässig
darauf bedacht, die verwirrende Fülle geistig geformter Weltgehalte
auf einfache und der jeweiligen seelischen Entwicklungsstufe des Werdenden
zugängliche Modelle zurückzuführen.
Es kommt also nicht einfach darauf an, daß eine Gemeinschaft da ist, in der und für die erzogen wird, sondern es kommt auf die sittlichen Gehalte an, zu denen sich die Gemeinschaft gleichsam wie das tragende Gefäß verhält. Deshalb kann diese Art der formenden Einwirkung auch niemals sich selbst überlassen bleiben, wie etwas, das sicher und gut „funktioniert“. Es muß immer eine Persönlichkeit da sein, die die Wirkungen auswählt und lenkt. Der Gruppengeist bedarf der Kontrolle und der ständigen Reinigung durch das Gewissen. Ein Gewissen aber hat immer nur der Einzelne. Entscheidend ist, solange es noch der Hilfe und Führung bedarf , d a s G e w i s s e n d e s E r z i e h e r s .
Der echte Erzieher stellt derartige philosophische Reflexionen kaum
an. Er besitzt ein ursprüngliches Organ für die Bahnen, in
denen der durch ihn hindurchwirkende Geist weht. Dieser Geist hat in
Gemeinschaften, zu denen wesensmäßig „das Erzieherische“ gehört,
wie etwa inFamilie und Schule, seine eigentliche Heimat. In andere wird
der geborene Pädagoge ihn hineintragen; ja er wird immer den Drang
empfinden, eine Jüngerschaft um sich zu versammeln, gleichsam eine
Sekte im Dienst der Menschenveredlung.
Es ist kein Geheimnis, daß sich diese schöne Hoffnung nicht
immer erfüllt. Ein Gebäude mit Klassenzimmern, ein staatlich
oder anderswie beauftragter Leiter, eine Schulordnung und ein Stundenplan
gewährleisten noch nicht, daß sich in diesem Rahmen der eigentliche
Geist der Erziehung verwirklicht. Dazu gehört ein Schwung besonderer
Art, der auch für ein hohes Gehalt nicht ohne weiteres zu haben
ist. Worauf es beruht, daß in einem solcher Häuser Funken
heiligen Feuers sprühen, in einem anderen aber nur eine kümmerliche
Flamme schwelt, ist vielleicht gar nicht auszusprechen. Genug: man merkt
es schon beim Hineintreten.
Die passive Müdigkeit, die so leicht in einer Klasse Platz greift,
kann nur dadurch überwunden werden, daß alle mit allen ins
Gespräch kommen und sich um etwas bemühen, das ihnen interessant
ist. Interesse heißt „Dabei-sein“. Was getrieben wird,
geht jeden an. Der Lehrer hört dadurch, daß er die Individualitäten
eine Zeitlang frei walten läßt, nicht auf, Autorität
zu sein. Er vermag die allgemeine Fröhlichkeit sofort wieder in
Ernst zu verwandeln, wenn genug gelacht worden ist. Vor allem: seine
Sache verbreitet deshalb immer eine wohltuende Temperatur weil sie immer
darauf angelegt ist, daß man innerlich an ihr wächst. Wo dieses
Gefühl durchbricht, ist ein guter Resonanzboden da. Wo es noch nicht
erzielt werden konnte, behält der bestgemeinte Bildungsprozeß etwas
von Abrichtung.
Es mag viel verlangt sein - aber wir träumen ja hier von einem
Ideal: Gerade das Selbstverständliche, Unmerkliche seines Tuns macht
den vollendeten Erzieher aus, und das pädagogisch gemeinte Zusammenleben
ist eben ein Miteinander von reifen und heranwachsenden Menschen, bei
dem Wertvolles geleistet wird, jedoch ohne den lauten Ausruf:“Hier
wird erzogen“.Das sollte die Regel sein. Natürlich gibt es „Ausnahmezustände“,
bei denen die stille Intention deutlicher hervortritt.
Falls jemand an dieser Stelle um nähere Auskunft bäte, wie
denn ein so schönes Ziel zu erreichen sei, so kann man ihn leider
nicht auf einen bestimmten Paragraphen eines Lehrbuches der Erziehungswissenschaft
verweisen. Aber unsere von vornherein als mißverstehbar bezeichnete
Redeweise vom „geborenen Erzieher“ kann doch durch weitere
Aufhellung der Zusammenhänge verbessert werden.Zum Erzieher gehören
eben Eigenschaften, die nicht auf Einsicht beruhen und daher weder lehrbar
noch lernbar sind. Vor allem bedarf er der ständigen Selbstdisziplin.
Man kann die Behauptung wagen:der wahre Erzieher lebt von dem Maß der
Selbsterziehung, das er an sich geleistet hat. Das Kapital von
Energie und Methodik, das dabei angesammelt worden ist, setzt sich täglich
in die kleine Münze des Einflusses auf andere um. Das Schönste
dabei ist, daß es nie erschöpft werden kann, es sei denn bei
völliger Erschöpfung der eigenen physischen Kräfte, die
allerdings bei einer so anstrengenden Tätigkeit wie der des Pädagogen
eine immer nahe Gefahr bedeutet.
Schon das Geheimnis des Disziplinhaltens klärt sich von diesem Zusammenhang
her auf . Mancher besitzt diese Gabe vom ersten Augenblick an. Wer sie
nicht hat, mag sonst ein sehr ehrenwerter Mann sein; aber zum rechten
Erzieher fehlt ihm Wesentliches. Das Ordnungshalten kann man auch nicht „lernen“.
Man muß vielmehr sein eigenes Inneres sorgfältig revidieren,
ob in ihm die Verhältnisse von Willensmacht und Unterordnung richtig
verteilt sind. Mit der sicheren Herrschaft über sich selbst fängt
alles Regieren von Menschen an. Äußere Zwangsmittel helfen
wenig. Innere Qualitäten sind entscheidend. Man muß freilich
hinzufügen es sind besondere Eigenschaften, die der Jugend je auf
ihren verschiedenen Stufen imponieren. Wer gerade über sie nicht
verfügt, mag im Rate der Weisen viel gelten: unser "geborener
Erzieher“ ist er nicht.
Arbeitsauftrag:
- Fassen Sie die Vorstellungen Sprangers vom Wesen des „geborenen Erziehers“ zusammen, stellen Sie sie dem Plenum in geeigneter Form vor und beleuchten Sie sie kritisch.
- Auch wenn Sprangers Titel vom „geborenen Erzieher“, seinen eigenen Hinweisen gemäß, nicht ganz wörtlich zu nehmen ist, so sind doch genügend Hinweise auf ein wörtliches Begriffsverständnis vorhanden, z.B. wenn Spranger von Eigenschaften spricht „die nicht auf Einsicht beruhen und daher weder lehrbar noch lernbar sind.“ Reflektieren Sie dieses Begriffsverständnis auf dem Hintergrund Ihrer Ausbildung.
- Wenn Sie Ihre Kolleg(inn)en und sich selbst mit dem von Spranger gezeichneten Bild des „geborenen Erziehers“ vergleichen, wie fällt dieser dann aus ? Ergeben sich für Sie daraus Konsequenzen für Ihre künftige Berufsausübung ?
Rainer Winkel: Die Persönlichkeit des Lehrers
Der Lehrer im ersten Drittel (und z.T. noch bis in die 60er Jahre) dieses
Jahrhunderts hatte das Problem zu lösen: Wie verwirkliche ich mit
Hilfe der mir von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten
Autorität die gewünschte Disziplin, Ordnung, Leistung und Gesinnung?
Demgegenüber fragt sich der heutige Lehrer: Wie erreiche ich ohne
den Rückgriff auf Autorität selbstverantwortliches Handeln,
Offenheit, Engagement und kritisches Bewußtsein? Die einen waren
also gehaßte „Dompteure“ (im schlechteren) und respektierte „Autoritäten“ (im
besseren Fall). Die anderen sind entweder verzweifelte „Beziehungsarbeiter“ (sofern
sie noch nicht resigniert haben) oder fluchtbereite „Alternativisten“ (die
eher aufs Land ziehen als gewisse Konsequenzen - z.B. die Konsequenz
aus dem Irrtum, der behauptet(e), Freiheit und Regellosigkeit seien identisch
und jeder um Ordnung Bemühte ein rechtsradikaler Chauvi, wenn nicht
gar ein offenkundiger Faschist).
Es bleibt die Notwendigkeit inmitten vieler Möglichkeiten, die Persönlichkeit
des Lehrers zu bilden. Aber wie und - in welchen Ausmaßen?
Eine Abbildung und einige Erläuterungen
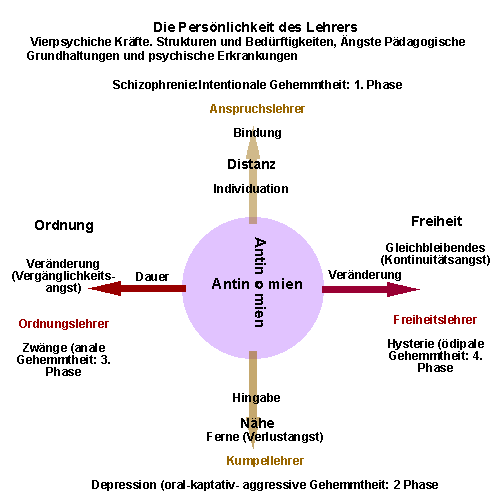 Einer der wichtigsten Aufsätze inmitten der ansonsten überquellenden
Literatur zur Lehrerpersönlichkeit stammt von Herbert
Gudjons [1],
dem es zum erstenmal gelungen ist, wesentliche Aussagen der psychoanalytischen
Theorie auf das Problem der Persönlichkeit des Lehrers so zu beziehen,
daß es pädagogisch sichtbar wird. Denn daran krankten bekanntlich
die älteren Lehrertypologien; sie klassifizierten und schrieben
fest, anstatt zu beschreiben und auf Veränderungen hin zu öffnen:
Einer der wichtigsten Aufsätze inmitten der ansonsten überquellenden
Literatur zur Lehrerpersönlichkeit stammt von Herbert
Gudjons [1],
dem es zum erstenmal gelungen ist, wesentliche Aussagen der psychoanalytischen
Theorie auf das Problem der Persönlichkeit des Lehrers so zu beziehen,
daß es pädagogisch sichtbar wird. Denn daran krankten bekanntlich
die älteren Lehrertypologien; sie klassifizierten und schrieben
fest, anstatt zu beschreiben und auf Veränderungen hin zu öffnen:
Wenn Christian Caselmann z.B. dem mehr der Sache zugewandten Lehrer das
Attribut logotrop zuordnete und den eher das Kind und seine Bedürfnisse
im Auge habenden einen paidotropen Lehrer nannte,
wenn die Waldorfpädagogik im Rückgriff auf Hippokrates von
sanguinischen, cholerischen, phlegmatischen und melancholischen Lehrern
spricht; die einen von intro- und extravertierten, die anderen von autoritären
oder laissez-faire-haften Erziehern reden ..., dann schweben all diese
Typisierungen in der Gefahr, daß in sie nicht(s) hineingelernt
werden kann - vor allem nicht durch die Betroffenen selbst. Genau da
setzt die Gudjons`sche Bemühung an. Denn selbstverständlich
gibt es „typische Züge“, „hervorstehende“ Merkmale
und „bleibende Eigenschaften“ des Lehrers. Und doch: Die
folgenden Erläuterungen wollen den von Gudjons aufgezeigen Neuansatz
aufnehmen und an einer entscheidenden Stelle fortführen.
Wer sich, bevor er hier weiterliest, einige Zeit in die obige Abbildung
vertieft, erkennt unschwer dies: Jeder Mensch spürt bestimmte Kräfte,
Bedürfnisse, Ängste, Grundhaltungen und Krankheitsgefahren
in sich und von seinen Mitmenschen her. Diese jeweilige Kraft zur, dieses
bestimmte Bedürfnis nach, manche Angst vor, eine bestimmte Grundhaltung
gegenüber sowie die eine oder andere Erkrankung an ... bilden ein
untrennbares und wechselseitig aufeinander wirkendes Ganzes, das lediglich
zum Zweck der Verständlichkeit im folgenden wie ein zu zergliederndes
Cluster von Merkmalen erläutert werden soll. Daß dabei die
Erkenntnisse von Fritz Riemann die theoretische Grundlage bilden, sei
ausdrücklich betont.[3]
Die Kraft zur Individuation, die Tendenz zur Selbstwerdung ist in jedem
Menschen vorhanden:Schon der Säugling lebt nicht nur mit der Realität
einer Mutter-Kind-Symbiose, sondern auch mit der Potentialität,
ein unverwechselbares eigenes Ich zu werden. Dazu freilich ist ein gewisses
Maß an Distanz zum Du nötig: Ich und Du sind nicht identisch
und deckungsgleich, sondern zwei Pole einer elliptischen Beziehung. Wird
nun dieses Bedürfnis nach Distanz gar nicht oder zu abrupt und überwältigend
befriedigt, entsteht Angst, genauer: „Die Angst vor Nähe“ (Schmidbauer),
davor: überhaupt Bindungen vertrauensvoll einzugehen, da sie entweder
die eigene Selbstwerdung bedrohen oder aber für den Aufbau des eigenen
Ich überflüssig sind. Besonders anfällig für solche
intentionalen Gehemmtheiten ist der werdende Mensch in der ersten, derjenigen
Phase also, in der Urvertrauen und basale Bindungen angestrebt, aber
auch erschwert und verhindert werden können. Schizothyme - also
markant (sich) abgrenzende - Verhaltensweisen können sich in einer
solchen Biographie zum Schutze der bedrohten Persönlichkeit ausbilden.
Wird nun diese Tendenz nicht aufgehalten, ein solches - zunächst
einmal völlig gesundes - Verhalten progredieren, extreme Ausmaße
annehmen, überwertig werden, dann schwebt ein solcher Mensch zumindest
in der Gefahr, in eine derjenigen Krankheiten zu taumeln, die wir dem
schizophrenen Formenkreis zuordnen.
Für alle anderen jedoch gilt: Menschen mit zur Individuation drängenden
Kräften, auf Distanz wertlegenden Bedürfnissen, vor allzu engen
Bindungen sie warnenden Ängsten sowie Menschen mit zur Abspaltung
unliebsamer Triebe, Gefühle und Gedanken tendierenden psychisch-sozialen
Gefährdungen entwickeln im Laufe ihres Lebens gewisse Grundhaltungen
und bringen diese ihre Persönlichkeit auch in ihren Beruf ein.
Soweit es sich um den pädagogischen handelt, könnten wir von
einem sachlich orientierten, eher kühlen und bedächtigen, um
Gerechtigkeit und Leistung bemühten Anspruchslehrer sprechen, der
nicht besser oder schlechter als seine Kollegen ist, sondern lediglich
anders. Problematisch wird diese Leherpersönlichkeit nur und erst
dann, wenn sie extreme Formen annimmt.
Um eben jene Übertreibung zu verhindern, kennen wir alle eine entsprechende
Gegenkraft in uns: die Kraft zur Hingabe an ein Du, aus der ein Bedürfnis
nach Nähe resultiert. Auch dieses aber muß entwickelt, erzogen,
gebildet werden, wenn die Angst vor der Ferne nicht überhand nehmen
soll. Wenn hier - vor allem in der oralen Phase - unnötige Versagungen
zugemutet werden, wer weder über den Mund (lat. Os,oris) noch seine
Hände genügend haben bzw. greifen (lat.captare)durfte, wessen
Besitzansprüche umgekehrt grenzenlos befriedigt wurden, wer gar
keine Frustrationen zu verarbeiten gelernt hat, wird auf Trennungen und
Versagungen weinerlich oder aggressiv reagieren.
Dieser Teil unserer Persönlichkeit sucht also Nähe, Wärme,
Verständnis und Liebe. Menschen, deren Kräfte, Bedürfnisse, Ängste
und Gefährdungen aus diesem Bereich heraus dominieren, konstituieren
eine Grundhaltung, die von einem Hang zum Emotionalen gekennzeichnet
ist. In der Schule werden sie gern als Kumpellehrer wahrgenommen, die
- in positiven Fällen - engagiert die Interessen von Schülern
vertreten, jedoch - in negativen Zusammenhängen - um die Gunst ihrer
Schüler buhlen.
Eine dritte Kraft in uns strebt nach Dauer und Kontinuität, will
Tradition und Konservation. Ein Bedürfnis nach Überschaubarkeit,
Regelhaftigkeit und Ordnung wird (vornehmlich in einer dritten Lebensphase)
grundglegt und kommt der Sehnsucht nach Erwartbarkeit und Übersichtlichkeit
entgegen. Wird es nicht oder nur unzureichend akzeptiert, mobilisiert
dies eine Angst vor der allzu raschen Vergänglichkeit, auf die oft
genug hektisch-panisch reagiert wird. Umgekehrt: Wo ein Kind (z.B. in
der Phase der Überwindung des unwillkürlichen Einnässens
und Einkotens) auf Ordnung, Regeln und Gehorsam gleichsam getrimmt wird,
ist die Gefahr groß, daß daraus krampfhafte Verhaltensweisen
und Einstellungen erwachsen, ja im Extremfall Zwangsneurosen entstehen.
Bleiben solche Übertreibungen hingegen aus, dann sorgt dieser Teil
unserer Persönlichkeit dafür, daß wir nicht chaotisieren
und sprunghaft-hektisch werden, sondern eine Haltung ausbilden, die gelassen
und konsequent inmitten von gelegentlich allzu großer Offenheit
auf Regelungen, Eindeutigkeiten und Überschaubarkeiten besteht.
Dominiert eine solche Einstellung bei einem Pädagogen, könnten
wir von einem Ordnungslehrer sprechen, der seine positiven Seiten im
Herstellen von strukturierter Gestaltung besitzt, in den negativen Zügen
jedoch den Pedanten und Ordnungsfanatiker ablegt.
Um eben jene Perversion zu verhindern, ist die Kultivierung einer vierten
Kraft (als Gegengewicht) nötig: die Kraft zur Veränderung,
zur Reform, zur Verbesserung. Nur Dauer hieße Erstarrung, nur Ordnung
bedeutet Leblosigkeit. Dieses Bedürfnis nach Neuheit, Freiheit und
Offenheit wird in derjenigen Phase besonders gelernt, in der die Beziehungen
des Kindes zu den Eltern und Geschwistern zum erstenmal problematisch
werden. Je nachdem, ob es den Vater und die Mutter als Konkurrenten oder
faire Partner, als Objekte von Libido und Destruktion oder als Subjekte
von Liebe und Aggression erfahren konnte, wird es entweder ödipal
fixiert bleiben oder ein auf Selbstbestimmung hin freigegebenes Wesen
werden können, wird es zu hysterischen (zur Schau stellenden) Reaktionen
neigen und in Konfliktfällen entsprechende Neurosen aktivieren oder
einen Gestaltungswillen dokumentieren, der die eigenen Rechte mit denen
anderer solidarisch auszutarieren versteht. Diese Grundhaltung in Richtung
Offenheit und Veränderung wird sich in allen Berufsgruppen finden.
Und auch in der Schule sind solche Freiheitslehrer nötig. Denn sie
verhindern Erstarrung und Friedhofsruhe, Abhängigkeit und Duckmäusertum,
Verabsolutieren sie ihre Einstellung jedoch, dann drohen Chaos und Rebellion,
Unverbindlichkeit und Gaukelei - von der Erziehung bis zur Unterrichtsvorbereitung.
Dies nun ist die entscheidende Stelle: Dem Lehrertyp entgeht man nicht
dadurch, daß man jedwede Akzentuierung und Profilierung vermeidet,
mit anderen Worten: alles sucht und nichts findet, harmoniesüchtig
jede Dissonanz scheut und alle Konflikte ausklammert. Nein, jeder Lehrer
soll und muß seinen „Charakter“, sein „Profil“,
seine individuelle „Persönlichkeit“ haben. Aber er
wird sie nur dann ausbilden können, wenn er das Extreme in sich
ebenso vermeidet wie das Nebulöse, dem Ichkult sich genauso wenig
hingibt wie der Diktatur des Man oder des Wir. Zu einer Persönlichkeit
wird nur derjenige Lehrer, dem alle vier Kräfte aufeinander angewiesene
Teile ein und derselben Biographie, Existens und Person sind; der keines
der divergierenden Bedürfnisse vernachlässigt oder verabsolutiert;
der jede Angst erst einmal zuläßt; und doch keine so weit
entfacht, daß sie in eine Krankheit umzuschlagen vermag. Kurz:
Vom Lehrertyp zur Lehrerpersönlichkeit kommen wir nur dann, wenn
jeder seine Eigenart bejaht und doch zum Zentrum hin sich orientiert,
d.h. nicht in Richtung der Pfeile schaut und quasi zentrifugale Aktivitäten
entfaltet, sondern der versucht, seine eigene Dominanz als Ausgleich
für andere Dominanzen in den Kreis eines spannungsgeladenen und
doch um den common sense bemühten Kollegiums einzubringen. Da mag
sich der eine eher „rechts oben“ oder „links unten“ verorten,
entscheidend ist seine Bereitschaft, den bzw. die jeweils anderen Kollegen
zuzulassen.
Eine solche Persönlichkeit könnte und würde ich einen
Antinomielehrer nennen, eben weil er kein Typ (mehr) ist, sondern weil
er einerseits die unverwechselbare Eigenart seiner Person sucht und ausbildet,
weil er andererseits aber auch die aus der Notwendigkeit anderer Persönlichkeiten
resultierenden Spannungen aus- und durchhält... .
Ein solcher Lehrer lebt nicht aus der permanenten „Kritik der Lehrerrolle“[4]
und doch wird er keine der ihm angetragenen und abverlangten Rollenerwartungen
kritiklos übernehmen. Er ist auch nicht jener „gebrochene
Lehrer“, der „gebrochenen Schülern auf die Beine zu
helfen"[5] versucht
(weil dies aber nicht gelingt, von einer Therapie in die andere flüchtet),
und doch wird er sensibel sein für Verletzungen, Ungerechtigkeiten
und persönliches Leid. Und schließlich ist er kein „Anti-Lehrer“ [6]
, dem Pädagogik allenfalls subversiv möglich erscheint, und dennoch
ist er kein bloßer Erfüllungsgehilfe von Staat und Gesellschaft.
Arbeitsauftrag:
- Fassen Sie die Vorstellungen Winkels von der Persönlichkeit des Lehrers zusammen, stellen Sie sie dem Plenum in geeigneter Form vor und beleuchten Sie sie kritisch
- Lassen sich Ihrer Meinung nach die Äußerungen Winkels in einem Kausalschema darstellen (im Sinne von „wenn... -> dann...“ oder „Ursache -> Wirkung“) ?
- Wie können Sie – nach Winkel – vom Lehrertyp zur Lehrerpersönlichkeit werden ? Könnten Sie Winkels Aussagen – auf Sie selbst bezogen – akzeptieren ?
Literaturverweise
[1] Herbert Gudjons:Lehrerpersönlichkeit im Aufwind. In:Westermanns Pädagogische Beiträge,34(6/1982),S.249-252.
[2] Christian Caselmann:Wesensformen des Lehrers (Original 1949) Stuttgart:Klett 4.1970
[3] Fritz Riemann:Grundformen der Angst, München-Basel:Reinhardt 1. Auflage 1975,13. Auflage 1981.
[4] Arno Combe:Kritik der Lehrerrolle.München:List 1971.(Combe ist - im Gegensatz zu den beiden weiter oben zitierten Autoren Ziehe und Bastian - Jg.1940 und einer der prominentesten Vertreter der 68er-Generation.Vgl. auch seine beiden folgenden Bücher:Krisen im Lehrerberuf. Bensheim: pädex Verlag 1979. Alles Schöne kommt danach. Die jungen Pädagogen. Reinbek:Rowohlt 1983.
[5] ders. In: H.Stubenrauch: a.a.O., S. 196f.
[6] ders.: a.o.O. S.193
Arno Combe: Kritik der Lehrerrolle
Der Schulmeister
Die intentionale Erziehung des Volkes und der „niederen Stände“ begann in den Handelsstädten des Mittelalters, wo ein dringendes Bedürfnis nach Kenntnissen in der Muttersprache, Lesen, Schreiben und Rechnen bestand. Die ersten Lehrer waren deshalb Lese-, Schreib- und Rechenmeister, die in den Hansestädten für die zahlungskräftige Kaufmannschaft zunächst auf privater Basis die Ausbildung ihrer Kinder in den Kulturtechniken übernahmen. Diese Lehrer rektrutierten sich aus Studenten, fahrenden Schülern oder gescheiterten und stellungslosen Theologen. Immer mehr nahm sich der städtische Rat des ‘niederen Schulwesens’ an, indem er entweder die Schulen selbst einrichtete und die Lehrer besoldete oder aber die privaten Lehrer konzessionierte und ihnen eine feste Stellung in der städtischen Verfassung zuwies. Unter solchen Bedingungen organisierte sich in Städten wie Lübeck, Frankfurt, Nürnberg, Augsburg und München um 1300 ein hauptberuflicher Lehrerstand, der sich nach dem Vorbild der Zünfte strukturierte.
Der Küsterlehrer
Mit der Reformation wird das Schulehalten zu einer Nebenfunktion des Dorfküsters, wie aus der Kursächsischen Kirchenordnung von 1580 oder aus Luthers Sermon „Daß man Kinder solle zur Schule halten“ zu entnehmen ist. Der Küsterlehrer wird hierbei ausdrücklich unter die geistliche Schulaufsicht des jeweiligen Dorfpfarrers gestellt. Diese Abhängigkeit ist vor allem beim Küsterlehrer verknüpft mit einer Anzahl ‘niedriger Kirchendienste’, vom Läuten bis zum Aufziehen und Stellen der Turmuhr, dem Reinigen der Kirche und dem Gesang bei Beerdigungen. Bungardt zählt 32 solcher Dienstleistungen auf. Der Lehrer war dabei finanziell völlig ungesichert und abhängig von den Schulgeldern der Eltern, die meist in Naturalien abgeliefert wurden.
Der Lehrerberuf als Sammelstätte für beruflich Gestrauchelte, Sekundärfunktion und Nebenverdienstquelle zahlreicher anderer Berufe
So fand etwa Friedrich II., daß ehemalige Soldaten und Unteroffiziere,
zum Felddienst untauglich und eines bürgerlichen Arbeitslebens ungewohnt,
für den Schulmeisterdienst gerade gut genug seien. Im preußischen
Generalschul-Reglement von 1763 forderte man vom Lehrer, daß er ein ‘nützliches’ Handwerk
als Haupttätigkeit ausübe, nicht zuletzt deshalb, daß sie ‘wissen,
wie sie ihre Zeit im Sommer, da auf dem Lande keine Schule gehalten wird,
zubringen’. Der Hauptgrund war aber, daß man sich vom kümmerlichen
Verdienst des Lehrers nicht ernähren konnte. Eine preußische Verordnung
von 1738 gesteht den Schullehrern das Schneidermonopol zu, um ihre wirtschaftliche
Lage zu verbessern. Noch 1806 befanden sich im Preußischen Lehrerseminar
109 Schneider, 21 Schuster, 5 Tischler usw.
Der Volksschullehrer gehörte also bis um 1800 mit Ausnahme der Lehrer
in den Städten ökonomisch wie geistig zum Proletariat, über
das sich selbst die niedrigsten Stände noch erhaben fühlten, wie
es das Spottlied vom „armen Dorfschulmeisterlein“ charakterisiert.
Verachtung, Rechtlosigkeit und Bevormundung von geistlicher und weltlicher
Obrigkeit waren weitere Kennzeichen des Standes. Motoren der gesellschaftlichen
Emanzipation des Lehrerstandes waren nun das Staatsbeamtentum, die permanente
Verbesserung der Ausbildung sowie die Volksbildungsidee in Preußen,
wo der Lehrer eine Art ‘Kulturmission’ zugewiesen bekam. Erst
im Jahre 1893 wurde das Schulamt in Preußen als ‘Hauptamt’ eingeführt,
was zwar einen kargen, aber dann doch regelmäßigen Lohn brachte.
Die entscheidende Verbesserung und Anhebung des Volksschullehrergehaltes
brachte aber erst die Zeit nach 1945. Übrigens in enger Wechselbeziehung
mit einer Anhebung des Ausbildungsstandards.
Einen wichtigen Mechanismus der sozialen Kontrolle stellt die eigene Erziehung
in einer bestimmten Herkunftsschicht dar. Diese führt bei ihm selber
zunächst dazu, daß er am Bestehenden nichts ändern will,
um die durch den Aufstieg erworbenen Privilegien nicht zu verlieren. Die
Lehrer tun zunächst das, was sie selber gelernt haben.
Die Lehrer haben eine aktivistische Wertorientierung verinnerlicht. Es wurde
an anderer Stelle gezeigt, wie sie die gesellschaftliche Ordnung als hierarchisch
ansehen. Nur die Beibehaltung einer klar nach Rängen geordneten Gesellschaft
bietet die Voraussetzungen, überhaupt aufsteigen zu können. Die
Vorstellungen, die sich mit dem Modell einer an Effizienzkriterien ausgerichteten
Gesellschaft verbinden, befestigen defensiv den Charakter der gegebenen Sozialordnung
gegenüber alternativen Modellen der gesellschaftlichen Produktion und
Distribution. Formen der Ungleichheit werden sanktioniert, wenn sie durch
individuelle Leistungen zustande kommen. Die Lehrer zeigen im Gefolge ihres
Leistungsdenkens ein starkes Abwehrverhalten nach unten: Man wehrt sich gegen
alle Nivellierungstendenzen, grenzt sich klar ab.
Der eigene soziale Aufstieg ist in der Regel mit einer peinlichen Einhaltung
der etablierten Regeln erkauft, mit einer ängstlichen Kopierung der
Normen der durch den Aufstieg erreichten Schicht: Konformität zahlt
sich aus. Das Konkurrenzverhalten, die individuelle Statuskonkurrenz, die
Rivalität innerhalb der eigenen Gruppe begrenzt allerdings die Fähigkeit
zu kollektivem politischen Verhalten.
Es gibt neben diesem ‘inneren Zwang’ zahlreiche äußere
Mittel, damit die Lehrer das tun, was von ihnen verlangt wird, wie man sie
auf ‘Vordermann’ bringen kann. Die Einhaltung der Erwartungen
durch den Lehrer von seiten einzelner gesellschaftlicher Gruppen wird dabei
durch ein soziales Kontrollsystem durchgesetzt. Dazu gehören etwa der
Entzug der gesellschaftlichen Anerkennung von seiten einer bestimmten Elternschaft,
die Notwendigkeit, sich im verwaltungsbürokratischen System an die Regeln
zu halten, wenn man Karriere machen will, z.B. die Möglichkeit der Schulverwaltung,
Druckmittel einzusetzen, die die berufliche und wirtschaftliche Existenz
bedrohen (Relegation, Kürzung des Gehaltes etc.). Die raffiniertesten
Kontrollmittel scheinen aber das Lächerlichmachen zu sein (Ironie, Spott,
Karikatur des Unzulänglichen), die soziale Ächtung (zum öffentlichen Ärgernis
degradieren), die teilweise „Stigmatisierung“ des Berufsstandes.
In einigen deutschen Untersuchungen ergibt sich ein ausgesprochen negativ
gefärbtes Stereotyp des Lehrers: „Der Lehrer wird vielfach im
Film als Karikatur des Unzulänglichen, hart und ohne Gefühl für
seine Zöglinge und nur in einzelnen Exemplaren menschlich dargestellt.“ Dieses
Stereotyp findet sich auch in der Literatur: auf der einen Seite Anklage,
Abneigung, ja Ausfälle gegen die Schule, auf der anderen Seite Spott,
Ironie und Verniedlichung. Die Schule und der Lehrer werden vielfach zum öffentlichen Ärgernis
degradiert.
Arbeitsauftrag:
- Fassen Sie Combes historisch – soziologische Deutung der Lehrerrolle mit den aus ihr resultierenden Folgerungen zusammen, stellen Sie sie dem Plenum in geeigneter Form vor und beleuchten Sie sie kritisch.
- Combe zielt mit seinen Ausführungen auf die Lehrerschaft gegen Ende der 60-er, Anfang der 70 er Jahre. Was hat sich Ihrer Meinung nach angesichts des 3. Jahrtausends geändert ?
- Sehen Sie bei den heutigen Lehrern soziologisch bedingte „Krankheitssymptome“ ? Welcher Art sind sie ?
Geißler: Der Lehrer - Lehrerrolle, Rollenvielfalt, Rollenkonflikt
1) Wie versteht sich ein Lehrer?
- Ist er ein Beauftragter des Staates und an dessen Weisungen gebunden?
- Ist er, in der Schule als einem „Subsystem der Gesellschaft“ tätig, mit deren Regeneration beschäftigt?
- Handelt er im Auftrag der Eltern, deren Erziehungsrecht im Rahmen institutionalisierter Lehre weiterführend?
- Wirkt er als Anwalt des Kindes gegenüber staatlichen Belangen wie auch gegenüber mißverstandenen elterlichen Erziehungsansprüchen?
- Ist er, als Fachlehrer in einem speziellen Bereich wissenschaftlich ausgebildet, Hüter der Tradition und auf deren exakte Weitergabe aus?
- Soll er Weichensteller der Zukunft sein, damit die „Utopie“ eines besseren Lebens, eines „neuen Menschen“ in einer „neuen Gesellschaft“ über Erziehung in der nächsten Genration Wirklichkeit wird?
Diese Fragen sind, selbst wenn die eine oder andere heute wieder besonders
populär geworden ist, allesamt alt (1). Teils wurden sie explizit in
heftigen Entgegensetzungen diskutiert, teils fanden sie mehr eine implizite
Behandlung. Dabei kam es mitunter zu bemerkenswerten Gegensätzen. So
hing beispielsweise das bekannte Bild Pestalozzis in Stans. Beispiel des
Lehrers als Anwalt des Kindes, jahrzehntelang in sehr vielen Schulklassen,
doch wohl als Aufforderung an die Lehrer, es diesem Vorbild gleichzutun.
Zur selben Zeit war indes die Schulgesetzgebung im wesentlichen darauf ausgerichtet,
im Lehrer einen Beauftragten des Staates zu sehen und ihn sehr eng an Reglementierungen
zu binden. Oder ein anderes Beispiel: Die Lehrplanentwicklung der höheren
Schule im letzten Jahrhundert hatte, im deutlichen Gegensatz zu Humboldts Konzeption, der Vermittlung von Tradition den Vorzug gegeben. Dem war durch
die Reformpädagogik, durch Nietzsches Schulkritik angestachelt, das
Eigenrecht des Kindes entgegengehalten worden. Oder: Während bei uns
die Elternrechtsdiskussion stark im Deklamatorischen blieb, hat die ganz
anders geartete angloamerikanische Schulorganisation Lehreranstellung wie
Lehrerentlassung stets als ein direktes demokratisches Verfahren interpretiert
(Schulgemeinde) und damit dem elterlichen Mitspracherecht umfangreiche Wirkungsmöglichkeiten
eingeräumt. Schließlich: Selbst in den verschiedenen Schulformen
haben sich divergierende Auffassungen über den Lehrer und seine Aufgabe
niedergeschlagen. So lag das besondere Pathos des ehemaligen Volksschullehrers,
bei aller organisatorischen Einschränkung der Möglichkeiten, vornehmlich
in einer Förderung der Schüler, weniger in der Auslese. Dagegen
war der Gymnasiallehrer von seinem Selbstverständnis her viel deutlicher
auf Auslese ausgerichtet, nämlich jene Schüler auszuwählen,
die sich im Umgang mit wissenschaftlichen Inhalten bewährten. In der
Literatur war es deshalb üblich geworden, den pädagogisch besonders
qualifizierten Lehrer mehr im Bereich der Volksschule anzusiedeln - man vergleiche
die einschlägigen Schriften aus der Zeit der Reformpädagogik über
den „geborenen Erzieher“ (2) oder „die Seele des Erziehers“ -,
den Gymnasiallehrer dagegen mehr in die Nähe eines Professors zu rücken,
der zuerst der Wissenschaft verpflichtet ist. Die Landerziehungsheimbewegung
(3) hatte diese Trennung aufzuheben versucht und war bemüht, auch in
weiterführenden Schulen den Erziehungsaspekt stärker hervorzuheben.
Diese Diskussion über das Selbstverständnis des Lehrers ist heute
noch längst nicht abgeschlossen. Sie wurde indes teils zurückgedrängt,
teils vergessen, besonders aber überlagert durch eine Diskussion, die
zunächst einmal gar nicht genuin pädagogischer Natur ist, sondern
soziologischer, nicht nur auf die Situation des Lehrers zutrifft, sondern
für alle Berufe. Das ist die Diskussion um Begriff und Sache „Rolle“ (4),
und die Behauptung, wir seien eine „Rollengesellschaft“.
3)Übertragen wir die Grundbezüge des Rollenkonzeptes auf die „Lehrerrolle“ (5), so zeigt sich sofort, daß der Lehrer innerhalb eines mehrteiligen Geflechts von Bezugsgruppen steht, die unterschiedliche Erwartungen an ihn haben:
- der Staat als einstellende Behörde, der ihn besoldet, ins Beamtenverhältnis bringt, ihn in eine Schulstelle einweist oder versetzen kann, seine Amtsführung beaufsichtigt, ihm Lehrpläne vorlegt;
- die Eltern, nach dem Grundgesetz die eigentlichen Erziehungsträger;
- sogenannte „Abnehmergruppen“ (ein heikles Wort, weil sich in ihm eine situationsunangemessene Analogie zum Markt ausdrückt), daß heißt jene, die auf einen kalkulierbaren Ausbildungserfolg warten (Berufsinstitutionen im besonderen, aber auch die Gesellschaft insgesamt, die einen handlungsfähigen, verantwortlichen, sich für die Belange des Gemeinwesens engagierenden Bürger erwartet).
- Da sind Kollegen, mit denen gemeinsame Schulordnungen, Klassenordnungen, Notenmaßstäbe und Schülerbewertungen, Hausaufgabenverteilungen, außerschulische Aktivitäten, Lehrplankoordinationen abzusprechen sind.
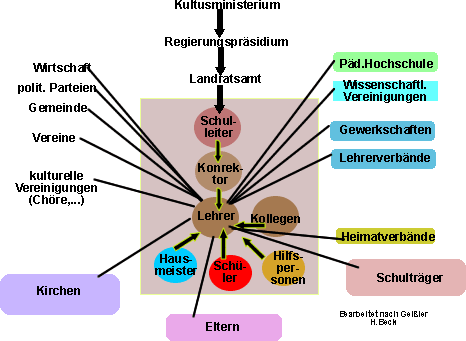
4) Der Lehrer steht, wie jeder andere Berufsausübende auch, nicht nur im Bezugssystem einer einzigen Rolle .Er ist, nimmt man das bekannte Beispiel Dahrendorfs (7), außerdem wahrscheinlich Familienmitglied, vielleicht Angehöriger einer Kirchengemeinde, eines Vereins, einer politischen Partei. So wichtig und bedeutsam solche ergänzenden Verpflichtungen auch sein mögen, sie bringen sicherlich zusätzliche Spannungen mit, die man in der Sprache der Rollentheorie Interrollenkonflikte (8) nennt. So beschränken mit der einen Position immer verbundene zeitliche Belastungen die Möglichkeiten des Engagements bei einer anderen. So können weltanschauliche Aussagen in einer Kirchengemeinde auf eine mehrheitlich anders orientierte Staatspolitik treffen. So können die weltanschaulichen oder politischen Vorstellungen der eignen Kinder von denen der selber als Lehrer tätigen Eltern differieren, was zu Spannungen zwischen den in den Unterricht einfließenden Wertmustern und Teilen der eigenen Lebenspraxis führt.
Problematischer sind indes die sogenannten Intrarollenkonflikte (9), die durch unterschiedliche Erwartungslagen der verschiedenen Bezugsgruppen innerhalb des Berufs selber auftreten. Einige Beispiele:
- Geht das, was der Staat erwartet, mit dem konform, was Eltern erwarten?
- Geht das, was Eltern erwarten, mit dem konform, was Schüler erhoffen?
- Geht das, was Schüler erwarten, konform mit dem, was von Kollegen, von Eltern, vom Staat erwartet wird?
Damit sind wir dann wiederum bei den eingangs genannten, zuerst von Hermann
Nohl (10) formulierten Fragen: In wessen Namen versteht sich der Lehrer zuerst?
Jetzt freilich etwas modifiziert: Wie löst er diese Konflikte? Schlägt
er sich einfach auf eine Seite, oder hält er sich durch Rückzug
auf fachspezifische Inhalte nach Möglichkeit überhaupt aus solchen
Konflikten heraus?
Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, daß der Lehrerberuf
ein offensichtlich sehr spannungsgeladener ist. Höchst unterschiedliche
Erwartungen verschiedener Bezugsgruppen bringen den Lehrer unter Belastungen,
die der nicht sieht, der den Lehrer einfach als Fachlehrer, daß heißt
als Fachmann für fachliche Informationen , interpretiert. Spätestens
hier zeigt sich dann aber auch, daß die aus dem Funktionalismus abgeleitete
Polyvalenzthese von einem sehr fragwürdigen Optimismus ausgeht und von
Naivität nicht frei ist. In ihrer Konsequenz wird eine berufsorientierte
frühe Praxiserfahrung nämlich zu lange aufgeschoben. Das ist aber
nur dann gerechtfertigt, wenn man von der Annahme ausgeht, als ob jeder für
den Lehrerberuf taugen würde, wenn er nur wolle. Der vielberedete Praxisschock
zeigt allerdings deutlich in eine andere Richtung. Der junge Lehrer erfährt
in der Regel zu spät die tatsächlichen Belastungen dieses Berufs.
Für den Wechsel in einen anderen Beruf ist es dann meist bereits zu
spät. Man arrangiert sich mit der Situation durch eine Art von Abkapselung,
daß heißt, Vermeidung von Konflikten durch Rekurs auf ein einziges
Rollensegment, weil man nicht zeitig genug gelernt und erfahren hat, der
Vielfalt der Erwartungen gerecht zu werden und sich darauf einzustellen.
In der Sprache des interaktionstheoretischen Rollenkonzepts: Diese Lehrer
können ihre eigene Identitätsbalance nur dadurch festhalten, daß sie
sich den vielfältigen Erwartungen der Bezugsgruppen gegenüber reserviert
verhalten:
- Abkapselung gegenüber den Eltern (sowenig wie möglich Kontakte),
- Abkapselung auch gegenüber den Schülern durch reine Sachgespräche und durch Vermeidung weiterreichenden persönlichen Engagements,
- Abkapselung auch gegenüber den Kollegen (der einzelne Lehrer isoliert sich als Fachlehrer).
Gegenüber diesen Gefahren muß die Mehrdimensionalität des
Lehrerberufes deutlich herausgestellt werden und damit die entschiedene Forderung
an die Lehrerbildung, auf diese mehrteilige Aufgabe rechtzeitig vorzubereiten. Über
diese Mehrdimensionalität der Lehrrolle (11) informiert das Schema.
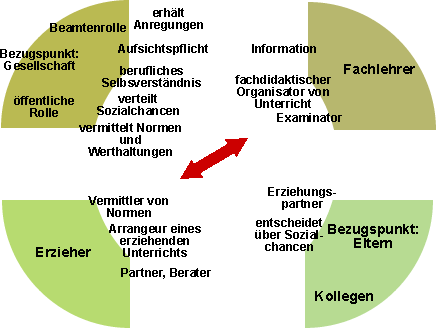
Damit sind die Gegensätze gekennzeichnet:
- Der Informator vermittelt in der Kühle wissenschaftlicher Distanz.
- Der Partner berät, appelliert, mahnt, hält zurück, treibt an.
- Das Vorbild stellt durch seine Person moralische Forderungen auf.
- Der Kontrolleur (Examinator) versagt sich gerade als Person notwendiger Objektivität wegen.
- Dem Erzieher ist der einzelne Mensch, das Individuum vorrangig, der pädagogische Bezug ist individualisierend (bereits Pestalozzi formulierte: „Erziehung geschieht nur unter Zweien“) (51).
- Für den Informator ist die Individualität des Schülers zwar nicht unerheblich, tritt aber vor der gleichmäßigen und nach Möglichkeit auch gleichzeitigen „Beschulung“ einer größeren Gruppe im Klassenverband zurück.
- Für den Fachmann ist Lehren informationsorientiert.
- Für den Erzieher ist Lernen ein existentieller Vorgang der Wertnahme, Wertbejahung, Weltorientierung.
- Für den Fachlehrer ist es eine zwar ärgerliche, für die zu vertretende Sache indes sekundäre Angelegenheit, wenn einzelne Schüler gewünschtes Wissen nicht nachweisen können.
- Der Erzieher, dem Vermittlung und Weitergabe von Werten nicht gelingt, gerät unter existentielle Betroffenheit.
Unter solchen Entgegensetzungen erst gewinnen die als Intrarollenkonflikte deklarierten Alltagsprobleme des Lehrers besondere Bedeutung, nämlich durch die Spannungen zwischen
- Partner versus Examinator,
- Berater versus Sozialchancenverteiler,
- Vorbild versus Fachmann.
Verstärkung des Erzieherischen muß indes nicht auf Kosten solider Wissensvermittlung geschehen. Es gibt, wie im Abschnitt „erziehender Unterricht“ schon dargelegt, eine Konzeption von Unterricht, in der sich beide Positionen zwar nicht reibungslos miteinander verbinden lassen, indes doch eine deutliche Verschränkung sichtbar wird:
- Erziehung in der Schule geschieht „auf dem Rücken von Unterricht“ und würde ohne Unterricht gar nicht stattfinden können,
- die erzieherische Komponente wiederum erweist sich als eine nicht hoch genug einzuschätzende motivationale Grundlegung auch des Fachunterricht.
Bedingung für einen solchen „erziehenden Unterricht“ ist freilich,
- daß Lehrer über diese Interdependenz Bescheid wissen und innerhalb der Lehrerbildung auf eine solche Unterrichtsorganisation vorbereitet werden (was gegenwärtig nicht ausreichend geschieht) und
- daß die Schule hinsichtlich ihrer Organisation, ihres Unterrichtsverständnisses wie auch der rechtlichen Absicherung der Lehrerkompetenz ihm die Handhabe gibt, erzieherisch wirken zu können.
Wenn heute, wie oft geklagt wird, sich viele Lehrer hinter ihrer Sachautorität
verschanzen, um überhaupt einigermaßen Kontrolle über die
Vorgänge in ihrer Klasse gewinnen zu können, sich also deutlich
unter Weglassung ihrer erzieherischen Aufgabe auf die Funktion des Fachlehrers
konzentrieren, dann zeigt dies deutlich mangelnde Voraussetzungen für
einen „erziehenden Unterricht“ an.
Alle diese Fragen lassen sich in einer zentralen zusammenfassen: Ist - und
wenn ja, wie - „erziehender Unterricht“ (27) möglich,
wie muß er beschaffen sein, und wie müssen Lehrer ausgebildet
werden, damit sie erziehenden Unterricht zu organisieren in der Lage sind?
Erziehung (im weiteren Sinne) im Raum der Schule hat drei wichtige Teilbereiche:
- Unterricht soll so organisiert sein, daß Erziehung im Bereich von Arbeitsmethoden und „Arbeitstugenden“ stattfindet und die Selbständigkeit des Schülers im selbsttätigen Lernen dadurch kontinuierlich erweitert wird;
- Unterricht soll so organisiert werden, daß Erziehung im Bereich sozialer Tugenden möglich wird;
Unterricht soll so organisiert sein, daß seine Atmosphäre, über die Gestaltung des Unterrichtsverlaufs vermittelt, zur Stärkung des Selbstwertgefühls des Schülers, zur Herstellung einer ausgeglichenen Identitätsbalance und einer angemessenen Ich-Stabilität beiträgt.
Arbeitsauftrag
- Fassen Sie die Vorstellungen Geißlers von der Lehrerrolle zusammen, stellen Sie sie dem Plenum in geeigneter Form vor und beleuchten Sie sie kritisch.
- Für Geißler resultieren die wesentlichen Probleme des Lehrerberufs aus den Schwierigkeiten, die viele Kollegen mit der Vielfältigkeit ihrer Rolle haben. Stimmen Sie ihm zu ?
- Können Sie Beispiele für konkrete Intrarollenkonflikte (oder sogar Interrollenkonflikte) aus Ihrer eigenen Praxis aufzeigen ?
- Informieren Sie sich in der Literatur über die „Polyvalenzthese“
Bauer, Kopka &. Brindt:
Pädagogische Professionalität und Lehrerarbeit
Der Begriff der pädagogischen Professionalität
Ein Ziel unserer Forschungsarbeit ist es, den Begriff der "pädagogischen Professionalität" zu klären und auszuschärfen. In einer früheren Arbeit (Bauer/ Burkard 1992) haben wir drei Ansätze der Professionalisierungsforschung unterschieden:
- den kriterienbezogenen Ansatz (z.B. Schwänke 1988)
- den historischen Ansatz (Burrage/Torstendahl 1990, Tenorth 1987)
- den auf pädagogische Arbeitsaufgaben bezogenen Ansatz (Devaney/Sykes 1988, Lieberman 1990)
Kriterienbezogener Ansatz
Zum Kernbereich von Professionalität gehören die Kriterien
Autonomie, Berufsethos, Reflexivität, Kooperation und wissenschaftliche
Basis der Berufsausübung (Berufswissenschaft) sowie eine besondere
Berufssprache.
Der kriterienbezogene Ansatz orientiert sich am Muster bestimmter, vollausgebildeter,
modellhafter Professionen. Hierzu gehören vor allem die Ärzteschaft
und die Juristen (vgl. zum folgenden ausführlicher Bauer/Burkard
1992).
Professionalität erfordert Autonomie, das heißt Entscheidungsspielräume über
die eigenen Arbeitsbedingungen, über die Formen des Umgangs mit
Klienten, über Maßnahmen und Empfehlungen. Autonomie braucht
einen Gegenspieler, der dafür sorgt, dass Spielräume und Freiheiten
nicht als Privilegien missbraucht werden. Dieser Gegenspieler ist das
Berufsethos. Der Fortfall äußerer Kontrollen muss durch Selbststeuerung
kompensiert werden. Und Selbststeuerung beruht auf der Bindung an überpersönliche
Werte, im Falle des Pädagogen etwa die Selbständigkeit und
Mündigkeit des Heranwachsenden oder, noch allgemeiner, das Wohl
des Klienten.
Reflexivität und Supervision kommen als weitere Merkmale einer modernen
Profession in sozialen Aufgabenfeldern hinzu. Wissen, was man tut, deutlich
wahrnehmen, wie man handelt, diese Stufen der Hinwendung zum eigenen
Handeln sind keineswegs alltäglich und selbstverständlich.
Sie setzen vielmehr eine besondere Haltung voraus, die durch die berufliche
Sozialisation gefördert werden kann.
Kooperation als weiteres Merkmal von Professionalität bezieht sich
zum einen auf die Ebene der interprofessionellen Zusammenarbeit. Dazu
gehört die Kooperation mit Fachleuten aus den Bereichen Forschung,
Beratung, psychosoziale Dienste usw. Zum anderen bezieht sich Kooperation
auf die intraprofessionelle Zusammenarbeit mit Kollegen der eigenen Berufsgruppe.
Was diese betrifft, zeigen empirische Untersuchungen immer wieder, dass
die Zusammenarbeit meist auf die Ebene der Unterrichtsvorbereitung beschränkt
bleibt. Gegenseitige Hospitationen und Team ‑ teaching finden
nur an wenigen Schulen statt (Bauer/Bussigel/Pardon/Rolff 1979, S. 113
ff, Schwänke 1988, S. 142, Roth 1994). Allerdings zeigt sich, dass
dort, wo besondere Anstrengungen zur Verstärkung von Kooperation
unternommen werden, sich das tatsächliche Kooperationsverhalten
auch langfristig ändert (Alterinann ‑ Köster 1990, S.
110, Roth 1994).
Am umstrittensten von den genannten Kriterien dürfte bei Pädagogen
der Bezug auf eine Berufswissenschaft sein, also die wissenschaftliche
Basis der Berufsausübung. Während allgemein akzeptiert sein
dürfte, dass Ärzte naturwissenschaftliche, insbesondere biologische
und physiologische Grundkenntnisse brauchen, dürfte es für
Pädagogen keinen vergleichbar unumstrittenen Bereich des Grundwissens
geben.
Im Rahmen unseres empirischen Forschungsvorhabens ist dies eine der zentralen
Fragen: Bestehen Verbindungen zwischen Handlungs‑ und Begründungswissen
von Lehrerinnen und Lehrern und wissenschaftlichem Wissen sowie wissenschaftlichen
Einstellungen und Sichtweisen? Welche Vorteile oder Nachteile haben solche
Verknüpfungen von Berufswissen und wissenschaftlichem Wissen?
Aufgrund der vorliegenden empirischen Studien lässt sich begründet
vermuten: Aus der Perspektive des kriterienbezogenen Ansatzes erweist
sich Lehrerarbeit in den Bereichen Kooperation, Berufswissenschaft und
Berufssprache als defizitär.
Historischer Ansatz
Dieser Ansatz fragt vor allem nach den Strategien, mit denen eine Berufsgruppe
Konkurrenten aus dem Feld schlägt oder verdrängt und sich einen
Anspruch auf bestimmte Tätigkeiten und die damit verbundenen Vorrechte
sichert.
Aus der Sicht des historischen Ansatzes betrachtet, sind erziehungswissenschaftlich
gebildete Pädagogen "Spätkömmlinge", die mit
Angehörigen anderer Berufsgruppen (Psychologen, Sozialwissenschaftler,
Gymnasiallehrer) konkurrieren müssen. Lehrer, die ihren Anspruch
auf Berufsausübung nicht aus einer erziehungswissenschaftlichen
Bildung ableiten, können sich zwar auf Traditionen berufen, deren
Glaubwürdigkeit ist aber ins Wanken geraten. Dies gilt insbesondere
für die in Deutschland übliche Beamtenlaufbahn mit dem ersten
und zweiten Staatsexamen als Zugangsvoraussetzung. Staatlicherseits definierte
Professionen wie der deutsche Lehrerstand sind eine historische Besonderheit
und in vielen anderen Ländern entweder erst gar nicht entstanden
(USA, Kanada, Niederlande, Großbritannien) oder inzwischen durch
flexiblere Formen der Rekrutierung abgelöst worden (Siegrist 1990).
Wir vermuten einen Zusammenhang zwischen der (unzureichenden) Lehrerprofessionalität
und dem Status der Erziehungswissenschaft im Gesamtgefüge der Wissenschaften.
Dieser Status lässt sich durch die Merkmale "neu, expansiv,
noch wenig anerkannt" beschreiben (vgl. hierzu Krüger/Rauschenbach 1994). Bemerkenswert ist die Zunahme der Praxisorientierung des Faches
und seiner Vertreter bei stagnierenden Werten in den Bereichen theoretisch‑historische
und empirische Orientierung (Baumert / Roeder 1994). Möglicherweise
ist das Potential der Erziehungswissenschaft für die Lehrerbildung
noch unerschlossen.
Auf Arbeitsaufgaben bezogener Ansatz
Grundlage dieses Ansatzes sind empirische Studien, in denen vorrangig folgende Fragen untersucht werden:
- Welche Arbeitsaufgaben haben die Angehörigen einer Berufsgruppe?
- Wie werden diese Arbeitsaufgaben bewältigt?
- Welche Fähigkeiten sind dazu erforderlich?
- Wie werden diese Fähigkeiten erworben und verbessert?
Eine herausragende Forschungsrichtung, die sich mit
der Bewältigung
eines bestimmten Typs von Arbeitsaufgaben befasst, ist der "Expertenansatz" (Bromme
1992). Der Expertenansatz fragt nach Wissenstrukturen, durch die sich
Experten von Laien, erfahrene Mitglieder einer Berufsgruppe von Anfängern
unterscheiden, oder er fragt nach Spitzenleistungen, die wiederholt erbracht
werden.
Eine zentrale Arbeitsaufgabe, die Lehrerinnen und Lehrer bewältigen
müssen, ist die Herstellung und Aufrechterhaltung einer Struktur,
einer Ordnung für die aufgabenbezogenen Interaktionen in Lerngruppen.
Diese Aufgabe wird als Unterrichtsführung oder "classroom management" bezeichnet
(Doyle 1986). Weitere Aufgaben sind die Entwicklung des Stoffes und die
Strukturierung der Unterrichtszeit (Bromme 1992, S. 77 ff.).
Im folgenden entwickeln wir einen Begriff der pädagogischen Professionalität,
der Elemente des kriterienbezogenen Ansatzes, der auf Arbeitsaufgaben
bezogenen Forschung und des Expertenmodells miteinander verbindet. Methodisch
gehen wir so vor, dass wir erfahrene Lehrerinnen und Lehrer, die ihre
Arbeitsaufgaben gut bewältigen, mit Lehrerinnen und Lehrern vergleichen,
die Weniger erfolgreich im Umgang mit Arbeitsaufgaben sind.
Bevor wir ein Ergebnis unserer Arbeit, eine vorläufige Definition
von pädagogischer Professionalität darstellen, müssen
wir zwei Begriffe klären, die in unsere Definition als wesentliche
Komponenten Eingang finden.
Das pädagogische Handlungsrepertoire
Damit sind Handlungsmuster gemeint, die auf hoch verdichteten
Wissensbeständen
basieren, also während der Handlungsausführung nicht vollständig
ins Bewusstsein gelangen. Die Handlungsabfolgen sind geübt und wirken
auf den Betrachter gekonnt.
Das Handlungsrepertoire ist individuell und führt zu einem persönlichen
Stil. Pädagogen, die sehr expressiv vor der Lerngruppe auftreten,
verfügen über ein gestisches und mimisches Ausdrucksrepertoire,
mit dem sie die Aufmerksamkeit der Lernenden wecken und aufrechterhalten
können. Andere haben ein ausgefeiltes Repertoire im Umgang mit wechselnden
sozialen Situationen und Unterrichtsformen entwickelt. Und eine dritte
Gruppe gestaltet die physikalische Umgebung der Lerngruppe zu einer anregenden
und zugleich die Konzentration fördernden Lernumwelt. Die wichtigsten
Dimensionen des Handlungsrepertoires werden in den folgenden Kapiteln
noch beschrieben und durch Fallbeispiele belegt.
Das professionelle Selbst
Das professionelle Selbst ist den übrigen Komponenten der Professionalität übergeordnet.
Es hat eine strukturierende und integrierende Funktion, ohne die jede
noch so differenzierte Teilkompetenz methodischer oder technischer Art
aufgesetzt wirken würde. Was ist dieses berufliche Selbst? Wie arbeitet
es? Welche Aufgaben nimmt es wahr? Wie entsteht es?
Zur Beantwortung dieser Fragen haben wir Theorien des Selbst aus den
Bereichen Kybernetik (Vester 1986), Neurowissenschaften (Edelman 1995)
und Psychologie (Csikzentmihalyi 1995) herangezogen.
Neurowissenschaftlich betrachtet, ist das Selbst eine Funktion des höheren
Bewusstseins. Höheres Bewusstsein entsteht, wenn im Zentralnervensystem
aktuelle Informationen mit Gedächtnisinhalten verknüpft und
unter emotionaler Beteiligung bewertet werden. Wahrscheinlich ist das
höhere Bewusstsein aus dem primären Bewusstsein hervorgegangen.
Das primäre Bewusstsein steuert die Aufmerksamkeit, indem es einlaufende
Informationen mit Zielen und Handlungsentwürfen verknüpft und
durch vergleichende Bewertung Auswahlentscheidungen trifft. Vereinfacht
gesagt: "Wir sind, was wir beachten" (Csikzentmihalyi 1995,
S.284).
Ein professionelles Bewusstsein ist demzufolge die integrierende und
auswählende Instanz, die die Aufmerksamkeit eines Pädagogen
so steuert, dass Informationen verarbeitet und Handlungsmuster ausgewählt
werden, die im Hinblick auf pädagogische Ziele relevant sind. Es
ist sinnvoll, zwischen einem primären und einem höheren professionellen
Bewußtsein und unterscheiden.
Das primäre professionelle Bewußtsein entsteht aus der pädagogischen
Interaktion und begleitet die Aufgabenerfüllung. Das höhere
professionelle Bewußtsein entsteht durch die Verarbeitung von Erinnerungen.
Es setzt Reflexion voraus und ist in hohem Maße sprachgebunden.
Ein professionelles Selbst entsteht aus dem höheren professionellen
Bewußtsein. Wenn diese Annahmen zutreffen, ergeben sich einige
weitreichende praktische und forschungsmethodische Konsequenzen.
Forschungsmethodisch ergibt sich die Konsequenz, dass das professionelle
Selbst, da es Teil des Bewusstseins ist, der Reflexion zugänglich
ist und beispielsweise durch Interviews, die Auswertung von Tagebuchmaterial
usw. erforscht werden kann.
Praktisch ergibt sich die Konsequenz, dass die Entwicklung des professionellen
Selbst durch das Individuum kontrolliert und höchstwahrscheinlich
durch Maßnahmen der Fortbildung gefördert werden kann.
Die vorrangige Aufgabe des professionellen Selbst besteht ‑ der
Theorie zufolge ‑darin, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden.
Dies setzt eine klare interne pädagogische Zielorientierung voraus.
Und es setzt voraus, dass einlaufende Hinweise und Informationen im Hinblick
auf pädagogische Handlungsmöglichkeiten wirksam kategorisiert
werden können. Nach diesem Exkurs folgt nun unsere Definition pädagogischer
Professionalität:
Pädagogisch professionell handelt eine Person, die gezielt ein berufliches Selbst aufbaut das sich an berufstypischen Werten orientiert, sich eines umfassenden pädagogischen Handlungsrepertoires zur Bewältigung von Arbeitsaufgaben sicher ist, sich mit sich und anderen Angehörigen der Berufsgruppe Pädagogen in einer nicht‑alltäglichen Berufssprache verständigt, ihre Handlungen unter Bezug auf eine Berufswissenschaft begründen kann und persönlich die Verantwortung für Handlungsfolgen in ihrem Einflussbereich übernimmt.
Die nachstehende Abbildung soll die Komponenten unserer Definition verdeutlichen und eine erste Andeutung der Komplexität möglicher Beziehungen zwischen dem professionellen Selbst und den Bereichen, in denen es agiert und lernt, liefern.
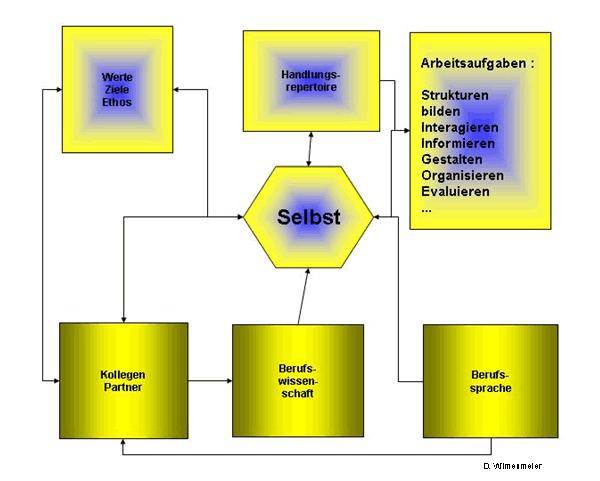
Bei den Richtungspfeilen in der vorstehenden Abbildung haben wir versucht,
eine Hauptrichtung anzugeben. Auch bei einseitig gerichteten Pfeilen
kann eine Rückkoppelung bestehen. Hervorgehoben werden in der Grafik
aber nicht die Rückkoppelungsbeziehungen, sondern die Richtung der
Aktivität. Nur wo die Aktivitäten in etwa gleicher Intensität
in beide Richtungen weisen, haben wir Doppelpfeile verwendet.
Die im Zentrum dunkel unterlegten Komponenten sind interne Bereiche oder
Dimensionen, die dort hellen Komponenten extern und Teil der Umgebungskultur
von Lehrerinnen und Lehrern.
Das Handlungsrepertoire kann direkt, ohne Kontrolle des Selbst, zur Bewältigung
von Arbeitsaufgaben abgerufen werden. In diesem Fall handelt es sich
um Automatismen, die dem Selbst unmittelbar nicht oder nicht mehr zugänglich
sind, wohl aber bewusst gemacht werden können und dann ‑ unter
günstigen Rahmenbedingungen ‑ auch kontrolliert werden können.
Wir haben in diese Definition die wichtigsten Komponenten des oben aus
der Literatur entnommenen Professionsbegriffs einbezogen. Neu an unserer
Definition ist die besondere Bedeutung eines beruflichen Selbst, das
im Zentrum steht und die übrigen Komponenten organisiert. Neu ist
auch die Hervorhebung des pädagogischen Handlungsrepertoires.
pdf der Seite
Hermann Giesecke: Das Ende der Erziehung
Die entpädagogisierte Schule
Die Schule in ihrer gegenwärtigen Gestalt verdankt ihre Existenz jenen Voraussetzungen der bürgerlichen Erziehung, die nun ihrem historischen Ende entgegengehen. Dies ist vermutlich der wesentliche Grund dafür, dass sie in einer tiefen Krise ihres Selbstverständnisses steckt, die die Reformmaßnahmen der siebziger Jahre eher verstärkt als gemildert haben. Die Klagen über undiszipliniertes, ja kollektiv‑infantiles Verhalten auch älterer Schüler, über fehlende Konzentrationsfähigkeit und motorische Unruhe, über Lärm, Unlust und Langeweile sind zu häufig und auch zu sehr übereinstimmend, als dass sie als Gejammer eines Berufsstandes abgetan werden könnten. Dies schlägt auf die Berufszufriedenheit vieler Lehrer zurück in Gestalt von oft krank machenden Zweifeln an der eigenen Qualifikation wie am Sinn der eigenen Profession.
Je weniger öffentliche Übereinstimmung darüber herrscht, wozu Schule eigentlich da ist und wozu nicht, desto mehr werden ihr Aufgaben aufgebürdet oder von ihr an sich gerissen, die mit ihrem ursprünglichen Zweck nichts mehr zu tun haben, bloß weil sie an der eigentlich zuständigen Stelle, zum Beispiel im Elternhaus, nicht erledigt werden.
Zudem erstickt die Schule in Erwartungen, die von außen an sie herangetragen werden in der Annahme, die staatliche Weisung könne hier irgendwelchen Übeln abhelfen. Wenn die Zahl der Verkehrstoten steigt oder die Wehrgesinnung sinkt oder die Friedensdiskussion in der Öffentlichkeit zu "einseitig" erfolgt, wird nach Erlassen gerufen, die die Schulmeister anhalten sollen, das Nötige unverzüglich beizubringen.
Die ursprüngliche Bildungsfunktion der Schule wird auch durch Verrechtlichung überdeckt. Besonders deutlich wird dies am Notenverrechnungssystem im Zusammenhang mit dem Numerus clausus. Hier wird sozusagen aus Äpfeln, Birnen, Pflaumen usw. ein Obstdurchschnitt errechnet. Wenn aber die einzelnen Schulfächer dazu dienen sollen, die Fähigkeiten wie auch die Leistungsgrenzen der Schüler erfahrbar zu machen, dann verlieren solche Verrechnungen ihren Sinn. Das gilt aber auch dann, wenn die Fächer weitgehend wählbar werden wie in der gymnasialen Oberstufe, weil dann die tatsächlich oder vermeintlich "schwachen" Fächer auch dann abgewählt werden können, wenn eine prüfende Auseinandersetzung mit ihnen gar nicht erst stattgefunden hat.
Die Bildungsfunktion der Schule ist ferner weitgehend überlagert worden durch eine Bewahrungsfunktion (custodiale Funktion): Kinder werden vormittags und teilweise auch nachmittags den Familien und der Öffentlichkeit entzogen, so dass die Erwachsenen ihren beruflichen und sonstigen Pflichten nachkommen können. In dieser Funktion ist die Schule natürlich vorwiegend an der Gegenwart der Kinder interessiert, weniger an deren Zukunft, und so suchen moderne didaktischmethodische Arrangements vergessen zu machen, dass hier "Schule" stattfindet, indem sie den Kindern den Aufenthalt möglichst attraktiv zu machen trachten, unentwegt nach deren "Bedürfnissen" forschen und dabei am liebsten die gängige Fernsehunterhaltung kopieren würden. Nun ist aber gerade die custodiale Funktion eine überflüssige Pädagogisierung, insofern ja "verwahrt" werden muss, wer als unfähig gilt, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Vielleicht liegt es auch daran, dass viele Kinder die Schule als langweilig und lästig erleben und keinen Sinn darin sehen, warum sie sich dort so lange Zeit aufhalten sollen.
Unsere These ist, dass die Kinder nicht sind, als was sie uns heute in den Schulen erscheinen, sondern dass sie durch das pädagogisierte Getue in Familien und Schulen dazu gemacht werden, dass ihnen erwachsenes Verhalten nicht abverlangt, sondern verwehrt wird. Wozu also ist Schule noch da, wenn Gegenwart und nicht Zukunft die dominante Zeitperspektive ist und wenn die Kinder ihre Zukunft verinnerlichen müssen? Dazu abschließend einige Thesen.
Wozu ist Schule nötig?
Zunächst muss die Schule sich wieder besinnen auf ihre eigentümliche Aufgabe im gegenwärtigen Sozialisationsprozess, also auf das, was nur sie dabei leisten kann und was weder die Familie noch die Massenkommunikation noch die Gleichaltrigen anzubieten vermögen. Alle übrigen Erziehungs‑ beziehungsweise Sozialisationsfelder entwickeln wichtige Fähigkeiten des Kindes, aber nur in der Schule können sich systematische, "sinnvolle" Vorstellungen über die wesentlichen Dimensionen der gesellschaftlichen und kulturellen Existenz ‑ über Politik, Wirtschaft, Kultur, Natur ‑ aufbauen. Die Aufgabe der Schule wäre also, durch "wechselseitige Erschließung" (Klafki) Kind und Welt in einen produktiven Austausch zu verwickeln, gerade in der massenmedialen Über‑ und deshalb auch Desinformiertheit kategoriale Schneisen anzubieten, um die herum sich angemessene Weltvorstellungen aufbauen lassen. Das kann nur die Schule leisten, und zwar durch das ihr eigentümliche Verfahren des systematischen, planmäßigen Unterrichts. Nur ein solcher Unterricht legitimiert eine Institution wie die Schule, die Menschen für eine bestimmte Zeit aus ihren sonstigen Lebenszusammenhängen herauszulösen (was für die Universität sinngemäß auch gilt). Insofern ist die immer wieder erhobene Forderung nach einer besseren Verbindung der Schule mit dem Leben problematisch, soweit sie mehr meint als eine didaktische Strategie. Zum Wesen des Unterrichts gehört, dass Menschen sich zu diesem Zweck in eine bestimmte Sozialsituation begeben, die so im sonstigen gesellschaftlichen Leben nicht anzutreffen ist.
Die Massenmedien, insbesondere das Fernsehen ermöglichen heute schon Kindern eine im Vergleich zu früheren Zeiten unvorstellbare Informiertheit. Aber sie liefern die "Fibel" nicht mit, mit deren Hilfe diese Informationen und Bewertungen zu einem kategorial erschlossenen Weltverständnis führen können. Ohne eine solche Ausbildung der Vorstellungskraft sind die Informationen und Deutungsstrukturen der Massenmedien nicht sinnlos, aber sie verbleiben auf der vordergründigen Ebene undurchschauter Sozialisation in Form von Anpassung an wechselnde Moden und herrschende Meinungen. Auch Schule wäre nur Teil eines solchen Sozialisationsprozesses, wenn sie nicht aufklärenden Unterricht zu ihrer eigentümlichen Aufgabe erklärte. Damit ist über das erforderliche didaktisch‑methodische Arrangement noch gar nichts entschieden. Der lehrerzentrierte Unterricht kann dazu ebenso gehören wie eine Theateraufführung oder die Reparatur von Motorrädern.
Bildung statt Erziehung
Ein in diesem Sinne auf die Ausbildung von Fähigkeiten zielender Unterricht muss jeglichen "Erziehungsauftrag" zurückweisen, der nicht aus den Bedingungen des Unterrichts notwendigerweise erwächst. Die Schule ist zum Beispiel nicht der Ort eines allgemeinen "sozialen Lernens" ‑ dafür sind die Familie und die Gleichaltrigen da ‑, sondern der Ort, wo man lernt, gemeinsam mit anderen geistige Arbeit ‑ und nicht irgend etwas ‑ zu betreiben. Die Schule kann nur insofern erziehen, als sie die dafür nötigen Tugenden und Verhaltensweisen abverlangt. Damit Unterricht gelingen kann, ist ein gewisses Maß an Selbstdisziplin, an Kooperationsfähigkeit, an Aufmerksamkeit und Artikulationsfähigkeit nötig. Diese Fähigkeiten und Verhaltensweisen muss die Schule mit ausbilden, aber darüber hinaus hat sie keine Legitimation mehr, zu irgend etwas zu erziehen; geschieht dies dennoch, so führt das nur zu einer mehr oder weniger willkürlichen, den jeweiligen Machtverhältnissen unterworfenen Politisierung, die den Konsens einer allen weltanschaulichen und demokratisch‑politischen Variationen verpflichteten Institution gefährden müsste. Insofern lernt man in der Schule für die Schule, für das Leben nur insoweit, als das Gelernte dort auch benötigt wird und die erworbenen Vorstellungen auch auf andere Situationen übertragbar bleiben. Unser Plädoyer zielt also auf eine Reduktion und Konzentration des schulischen Anspruchs. Die Schule kann nur noch ein Teil des kindlichen Lebens sein, vielleicht nicht einmal der wichtigste, insofern die Sozialisation außerhalb der Schule nicht hintergangen werden kann.
Entrechtlichung des Unterrichts
Der Bildungsauftrag der Schule kann nur insoweit wieder zur Geltung kommen, als der Unterricht entrechtlicht wird. Da die Verrechtlichung sich insbesondere an den sozialen Folgen von Schulnoten und Zeugnissen festmacht, ist sie nachhaltig wohl nur dadurch zu verringern, dass die Automatik von Schulabschluss und Berechtigung aufgehoben wird. Das gilt vor allem für die Ebene des Abiturs. Das Abitur darf höchstens noch eine Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums sein, keine automatische Berechtigung mehr dafür. In diesem Falle wären die Zensuren ohne unmittelbare soziale Folgen und könnten wieder stärker eine pädagogische Funktion bekommen (zum Beispiel Maßstab für den individuellen Lernfortschritt sein). Kein potentieller Arbeitgeber, der die Sache durchschaut hat, macht heute die Schulnoten zum Hauptkriterium einer Einstellung, das gilt von der Hauptschule bis hin zu akademischen Abschlüssen. Je weniger nämlich Schule und Hochschule mit ihren Zeugnissen die Zukunft ihrer Absolventen im Blick haben können, um so mehr neigen sie dazu, deren Gegenwart etwas Gutes zu tun, zum Beispiel durch relativ "günstige" Beurteilungen. Wie schon gesagt, ist unser Berechtigungswesen eng verbunden mit jener überlieferten Vorstellung des an der Zukunft des Kindes festgemachten sozialen Auf‑ und Abstiegs. Statt eines solchen Systems von "Schullaufbahnen" brauchen wir ein flexibles Bildungsangebot, das nicht weite Zukunftsperspektiven versteinert, sondern kürzere attraktiv macht, die der zunehmenden Gegenwartsorientierung entgegenkommen. Die überlieferten relativ frühen und kaum wieder rückgängig zu machenden Bildungsgangentscheidungen (zum Beispiel nach der Grundschule Übergang aufs Gymnasium) sind historisch überholt.
Ebenso historisch überholt ist die lange Fixierung des Jugendalters auf Schule und Hochschule. Schul‑ und Studienzeiten sollten im allgemeinen verkürzt, dafür spätere "schulische Phasen" während der Arbeitszeit attraktiv gemacht werden. Die langen Schulzeiten tragen nicht unwesentlich zur pädagogischen Infantilisierung des Jugendalters bei, und je länger die Schule dauert, um so weniger attraktiv kann sie sein, sie hat dann einfach immer weniger zu bieten für die Zeit, die sie beansprucht. Vielleicht ließe sich das mildern, wenn die Schule sich stärker gegenüber ihrer Umwelt öffnen würde, wenn sie zum Beispiel Aufgaben der sozialen und kulturellen Mitgestaltung dieses Umfeldes übernähme und vor allem Personen aus diesem Umfeld ‑ Politiker, Vertreter von Organisationen, Handwerker usw. ‑ in den Unterricht hinein holte.
"Pädagogische Verantwortung" des Lehrers
Die tiefe Verunsicherung der Schule hat sich nicht zuletzt niedergeschlagen in einer Verunsicherung des Umgangs zwischen Lehrern und Schülern. Die Skala der Beziehungen reicht von traditionell‑autoritär bis kumpelhaft. Wenn niemand mehr so recht weiß, wozu die Schule da ist, wird auch unklar, wie man warum miteinander in ihr umgehen soll. Gerät jedoch wieder in den Blick, dass es zentrale Aufgabe der Schule ist, durch Unterricht wichtige Fähigkeiten der Schüler zur Entfaltung zu bringen, dann vertritt der Lehrer dem Schüler gegenüber zunächst einmal eine "Sache", die er ihm beibringen will. Das dafür nötige didaktische Handwerk sollte er möglichst gut beherrschen, ohne dabei Fernsehen und BRAVO imitieren zu wollen. Er sollte seinen professionellen Ehrgeiz darin sehen, Ängstliche mutiger zu machen, Schwächere zu ermuntern und zu fördern und vor den Stärkeren zu schützen. Im übrigen sollte er eine Kommunikationsfähigkeit zeigen, in der auch Humor und Nachsicht einen Platz haben. Fachlich‑didaktische Kompetenz plus wenigstens mittlere Kommunikationsfähigkeit ‑das ist zunächst einmal die Grundlage des "pädagogischen Bezugs", die der Lehrer dem Schüler vorzugeben hat, damit er sich daran orientieren kann. Weder die Sache noch die Kompetenz ihrer didaktischen Präsentation können dem Schüler zur Disposition stehen und also auch nicht die für den Umgang mit der Sache nötigen Verhaltensweisen. jeder Erwachsene, der von anderen etwas lernen will, weiß das und akzeptiert die entsprechenden Regeln. Sogenannte "Disziplinschwierigkeiten" zu dulden oder überhaupt diese Regeln den Schülern zur Disposition zu stellen ist also kein Zeichen von Großzügigkeit oder von demokratischer Haltung, sondern von Vorenthaltung des schon möglichen Erwachsenenhabitus, von überflüssiger Pädagogisierung.
Aber wie bei den Eltern, so hat auch die "pädagogische Verantwortung" des Lehrers ihre Grenze. Er kann zum Beispiel die fehlende Bereitschaft des Schülers zur Mitarbeit letzten Endes nicht unterlaufen, obwohl ihm möglicherweise die Mär aufgebunden wurde, man könne jeden Schüler motivieren, wenn man es nur richtig verstehe. Fraglich ist vielmehr schon, ob man überhaupt planmäßig und gezielt einen Menschen motivieren kann, oder ob es nicht vielmehr darauf ankommt, vorhandene Motivationen nicht zu zerstören und im übrigen ein Klima zu schaffen, in dem vielleicht neue Motivierungen entstehen können. Die Welle der Pädagogisierung hat die "Machbarkeit" von Lernen und Bildung in sehr unrealistischer Weise propagiert. Hier müssen die Verantwortlichkeiten wieder klar verteilt werden. Die pädagogische Verantwortung des Lehrers hat den Willen zur Mitarbeit zur Voraussetzung, ganz unabhängig vom Maße der Lernfähigkeit. Jede Lernfähigkeit kann gefördert und weiterentwickelt werden, aber für den Willen dazu ist nicht mehr der Lehrer, sondern der Schüler verantwortlich beziehungsweise ‑je nach Alter ‑ seine Eltern. Dass es immer am Lehrer liegt, wenn die Schüler nicht lernen wollen, ist einerseits Signal für ein Abschieben der Verantwortung, andererseits ein Gebräu, von dem sich die Pädagogisierung nährt.
Eine weitere Grenze der "pädagogischen Verantwortung" liegt darin, dass der Lehrer nicht Mitglied der Familie seiner Schüler ist und infolgedessen weder die Pflicht noch das Recht hat, die ganze Persönlichkeit seiner Schüler "in den Griff zu nehmen". Weder das Seelenleben des Kindes noch überhaupt der Kern seiner Persönlichkeit gehen ihn etwas an. Gestörte Kinder, die vielleicht eine Therapie brauchen, kann er nicht selbst therapieren. Weder die Familie noch die Schule ist eine therapeutische Institution. Zu den Persönlichkeitsrechten der Schüler gehört auch ihre unterhalb der formellen Unterrichtssituation verlaufende "Subkultur" mit ihrem eigenen Jargon und mit eigenen Ritualen; der Lehrer sollte sie weder durch psychologische Tricks in die Hand zu bekommen versuchen noch sich ihr anbiedern. Zum
Anbiedern" gehört auch, diese informelle soziale Dimension zum Gegenstand des Unterrichts zu machen in der Hoffnung, daß dies "motivieren" könne. Solche Hoffnungen trügen fast immer, und zwar vor allem deshalb, weil die Schüler von der Schule etwas anderes, irgendwie "Wichtiges" erwarten, was sie sich gerade nicht selbst beibringen können. Die Schule nimmt die Schüler nicht zuletzt dadurch ernst, dass sie auch die kulturelle Distanz deutlich macht, die zwischen der Subkultur und ihren eigenen Ansprüchen besteht.
"Wahrheit" und "Richtigkeit" als regulative Ideen
Eine sehr problematische Folge des pädagogisierten Denkens ist, wie wir sahen, dass der "Eigenwert" der Sachverhalte aus dem Blick geraten ist zugunsten ihrer Verwertbarkeit beziehungsweise ihrer sozialen Instrumentalisierung. Dies ist ein Problem allen Lehrens und Unterrichtens, weil ja die jeweilige "Sache", um verstanden werden können, für das Bewusstsein der Schüler beziehungsweise Studenten umstrukturiert, didaktisch aufbereitet werden muss. Im Akt der Vermittlung ändert eine Sache ihre Struktur, weil sie mit der Erfahrung des Schülers (zum Beispiel mit seinem bisherigen Wissen) eine Verbindung eingehen muss. Es gibt hier gewissermaßen "Transportverluste". Das Problem gab es auch im Rahmen der alten Bildungstheorie. Aber dort war die Didaktik der Versuch, die Lehr- und Lernbarkeit in der Sache selbst aufzuspüren, in ihrer vereinfachten Grundstruktur oder in ihren exemplarischen Teilen oder in phänomenologischen Reduktionen. Um etwa komplizierte Maschinen begreifbar zu machen, wurde versucht, die notwendigen Elemente von Maschinen überhaupt zu ermitteln, um von daher das Komplexe als Variation des Einfachen erklären zu können.
Die modernen Curriculum‑Konstruktionen und vor allem kommunikativ
beziehungsweise interaktionistisch orientierte didaktische Konzepte haben
jedoch diese Art der didaktischen Analyse im Prinzip verlassen. Die kommunikativ
orientierten Konzepte verweisen etwa nicht zu Unrecht darauf, dass zumindest
bei all jenen "Sachen", die einer Bewertung unterliegen, weil
sie für das Leben der Menschen von mehr oder weniger großer Bedeutung
sind, diese Bewertungen in die Definition der Sache eingehen, über die
dann in der Familie oder Schule kommuniziert wird. Diejenigen aber, die über
diese Sache so kommunizieren, seien außerstande, jenseits der Kommunikation
einen objektiven Maßstab ‑ also die "Wahrheit" ‑zu
finden. Da andererseits aber jede Definition der Sache gleichberechtigt sei ‑ es
sei denn, jemand wie der Lehrer habe die Macht, seine Definition durchzusetzen
(und wer will einen solchen Makel schon auf sich laden) ‑, sei die Sache gleichsam
nur noch ein Thema, das den Anlass für eine Kommunikation bildet,
in der es nicht mehr um die Suche nach "Wahrheit" oder "Richtigkeit" gehe,
sondern um die Beziehungsdimension, wie nämlich sozio ‑emotional
mit den Ansichten der anderen umgegangen wird (z. B. autoritär oder
tolerant, teilnehmend oder ablehnend usw.).
Nun gibt es sicher soziale Orte, an denen diese Art des miteinander Redens
und Denkens ihre Berechtigung hat. Die Familie zum Beispiel ist keine Schulstube,
und sich mit der je subjektiven "Wahrheit" der anderen (nicht zuletzt
auch der Kinder) auseinander zusetzen, ist zweifellos wichtig. In politischen
Versammlungen und bei Gesprächen im Freundeskreis dürfte es ähnlich
sein. Aber jeder, der spricht, glaubt an "seine" Wahrheit beziehungsweise
Richtigkeit ‑ falls er die anderen nicht täuscht. Offensichtlich
kann niemand auf eine solche regulative Idee verzichten, auch wenn er zum
Beispiel aus Höflichkeit "seine" Wahrheit nicht durchsetzen
will.
Aber Schule und Hochschule bedürfen dieser regulativen Idee zu ihrer institutionellen Legitimation. Wenn zum Beispiel die Schule nicht mehr den Anspruch erhebt, in ihrem Unterricht herauszufinden, "Wie es wirklich ist", dann kann man Schülern nicht mehr weismachen, dass Schule für sie von Bedeutung sei. Sich über etwas angeregt unterhalten kann man auch anderswo. Dass selbst die Wissenschaft Wahrheit und Richtigkeit immer nur annäherungsweise erreichen kann, ist kein Einwand, denn ohne eine solche Idee würde alles Denken in der bornierten Unmittelbarkeit von Kommunikationen stecken bleiben. Schule ist der soziale Ort und Unterricht das dabei nötige Verfahren, diese Borniertheit zu durchbrechen, indem Kommunikationen verpflichtet werden auf eine Idee, die außerhalb ihrer Grenzen liegt. Eine Schule, die dies aus dem Blick verliert und statt dessen die Kinder verwickelt lässt in ihrem gewohnten Denken, Reden und Meinen, pädagogisiert sie nur und enthält ihnen einen Anspruch vor, der sie ein Stück erwachsen machen könnte. Die unterrichtliche Autorität des Lehrers erwächst also nicht nur aus seiner fachlichen Kompetenz, sondern auch daraus, dass er diese regulativen Ideen geltend macht.
Nun hat aber der Unterricht nicht nur eine fachliche Dimension, sondern ‑ wie
bereits erwähnt ‑ auch eine normative. In allen Fällen, wo
unterschiedliche Bewertungen von Sachverhalten möglich sind, nimmt der
Lehrer eine andere Rolle ein. Über Bewertungen gibt es unterschiedliche
Meinungen, und diese Meinungen beruhen auf unterschiedlichen Erfahrungen.
Die Erfahrungen von Menschen sind aber grundsätzlich gleichberechtigt,
die des Schülers sind nicht "wertloser" oder "schlechter" als
die des Lehrers, sondern nur anders. Der Respekt vor anderen Meinungen ist
also der Respekt vor anderen Erfahrungen und das heißt: vor einem anderen
gelebten Leben. Auf dieser Ebene gibt es also von der Sachlage her ‑ und
nicht, weil der Lehrer es "aus pädagogischen Gründen" gewährt ‑ Gleichberechtigung
zwischen Schülern und Lehrern. Aber im Unterschied zur Sozialsituation
der Familie geht es in der Schule nicht um einen privaten Meinungsaustausch,
vielmehr steht hier der gleichberechtigte Austausch von Erfahrungen ebenfalls
unter einer die unmittelbare Kommunikation transzendierenden Idee, nämlich
der Idee des "richtigen gemeinsamen Lebens". Die individuelle
Erfahrung wird eingebracht mit dem Ziel, sie durch den Austausch oder auch
die Konfrontation mit anderen Erfahrungen weiterzuentwickeln, sie zu differenzieren
und zu präzisieren; insoweit gehört dieser Prozess zum Bildungsauftrag
der Schule. Darüber hinaus aber geht es um die Suche nach Lösungen
für das Gemeinsame des weiteren Zusammenlebens.
Diese objektivierende Perspektive muss der Lehrer einbringen, um zu
verhindern, dass es bei der unverbindlichen Privatheit eines Meinungsaustausches
bleibt. Schulischer Unterricht ist also in verschiedener Hinsicht gebunden
an "Ansprüche des Objektiven": Sachlich an die regulativen
Ideen von "Wahrheit" und "Richtigkeit" und normativ an
die regulative Idee des "richtigen gemeinsamen Lebens". Nur insoweit
der Unterricht sich diesen Ideen unterwirft, kann die Schule etwas Eigentümliches
zur Entfaltung der Fähigkeiten ihrer Schüler beitragen. Alles andere
machen die Familien, die Gleichaltrigen und die Massenmedien mindestens genauso
gut.
Fazit
Kinder müssen ihre Zukunft schon früh selbst verantworten, sie also verinnerlichen. Diese Tatsache bricht die Macht der Erwachsenen als Erzieher. Daraus muss sich ein neuer Umgang zwischen den Generationen in der Familie ergeben, aber auch eine Neubesinnung über die Aufgaben der Schule. Vor allem muss den Kindern ihre Verantwortung auch tatsächlich entgegen den Tendenzen einer allumfassend Pädagogisierung eingeräumt werden. Das gilt nicht zuletzt auch für die Schulleistungen. Ganz gleich, wie gut oder schlecht die Schule erscheinen mag, aus der Perspektive der Schüler ist sie dazu da, in einem begrenzten, aber wichtigen Bereich ihre Fähigkeiten zu entdecken, damit sich daraus eine Perspektive des künftigen Lebens entwickeln lässt.
Zur Entdeckung der Fähigkeiten gehört aber auch die Entdeckung der Grenzen, und mit beidem muss man leben lernen, beides zusammen erst lässt eine Perspektive für ein selbstverantwortetes Leben entstehen. Kinder haben heute auch außerhalb der Schule eine Fülle von Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten zu entfalten. Mit dem, was sie daraus machen, müssen sie auch existieren, ohne dass sie dafür andere ‑ zum Beispiel die Eltern ‑ haftbar machen können.
Erziehen heißt immer noch in erster Linie unterstützen und ermutigen, aber immer weniger, auch die Verantwortung für den Erfolg zu übernehmen. Die Kinder wollen nicht nur früh erwachsen sein, sie müssen es auch in einer Zeit, die die Mauern eingerissen hat, die ihre Kindlichkeit früher umgaben und schützten. So zu tun, als sei das anders ‑ das eben ist Pädagogisierung. Wir sollten die Kinder erwachsen sein lassen, ihnen die Verantwortung dafür so früh wie möglich übertragen und ihnen bei den daraus resultierenden Schwierigkeiten unsere Hilfe anbieten.
Hans Christian Thalmann: Den Schulalltag bestehen.
Psychohygiene des Lehrerberufes.
Ein Fall
Es handelt sich dabei um die Unterrichtsbeobachtungen zweier Studentinnen bei einer Junglehrerin. Elke B., die, da sie mit den Studentinnen befreundet ist, in dem Bericht mit ihrem Vornamen Elke erscheint. Berichtet wird über eine Geschichtsstunde in einer Hauptschulklasse.
„Zu Beginn der Stunde teilt Elke einen Arbeitsbogen aus, den die
Schüler in Partnerarbeit ausfüllen sollen. Der Inhalt scheint
diese nicht zu interessieren, sie bestürmen Elke nur mit formalen
Fragen: ’Welche Farbe sollen wir nehmen? Sollen wir Linien ziehen?
Wie lange haben wir Zeit?’ Sie sind es offensichtlich gewohnt,
nach den Befehlen des Lehrers Arbeitsaufträge auszuführen,
und verlangen entsprechend, daß der Lehrer genau vorausbestimmt,
was sie tun sollen.
Elke erfüllt diese Erwartungen jedoch nur teilweise. Schon am Anfang
verteilt sie zunächst das falsche Arbeitsblatt. Sie ist unsicher,
kann aus Nervosität die Stelle im Geschichtsbuch, die die
Schüler als Hilfe verwenden sollen, nicht finden und gibt unangemessene
Arbeitsaufträge. Daraufhin entsteht mehr und mehr Unruhe in der
Klasse. Auf die aggressiven Fragen der Schüler ‘Was sollen
wir den machen?’ reagiert Elke mit der Antwort:’ Überlegt
doch selbst’... .
Nach und nach nützen immer mehr Schüler den von Elke gewählten
Freiraum und ihre Unsicherheit aus und entwickeln Taktiken, um den Unterricht
gezielt zu boykottieren. So behaupten sie plötzlich, ihre Geschichtsbücher
nicht mitgebracht zu haben, weil Elke dies am Tag zuvor nicht angekündigt
habe. Gleichzeitig lassen einige ihre Bücher unter der Bank verschwinden.
Elke durchschaut das Spiel nicht, glaubt, sie hat es tatsächlich
vergessen und geht daran, die vorhandenen Bücher zu verteilen, die
jedoch dauernd wandern und zwischendurch verschwinden.
Elke wird zunehmend nervöser, scheint keinen Überblick mehr
zu haben und reagiert auf den immer stärker werdenden Krach persönlich
betroffen. Sie versucht, die Disziplin durch sehr laute Befehle, Ermahnungen
und Drohungen wiederherzustellen. Sie duldet jetzt nicht mehr den geringsten
Regelverstoß, ohne darauf einzugehen, wodurch sie immer beschäftigter
und aggressiver wird und sich in weitere Widersprüche verwickelt.
So verbietet sie z.B. einem Schüler das Kaugummikauen zuerst mit
der Begründung, daß es der Direktor verboten habe .’Deshalb
darf ich dir das nicht durchgehen lassen.’ Als der Schüler
jedoch jetzt offen provozierend weiterkaut, schreit sie ihn an: „Diese
ekelhafte Kaugummikauerei kann ich nicht mehr ertragen“ - und wirft
ihn aus der Klasse. Während sie vorher das Verbot mit ihrer Abhängigkeit
vom Schulleiter begründet hat, wird jetzt deutlich, daß sie
es selbst emotional vertritt.
Als sie sich wieder beruhigt hat, appelliert sie an die Einsicht der
Schüler in die Notwendigkeit einer funktionaler Disziplin . sie
läßt dabei offen, daß sie selbst unter Druck steht.
Ich muß doch für einen geregelten Unterricht sorgen,sonst
kreige ich Ärger. Da die Schüler diese Erklärung oder
Entschuldigung offensichtlich nicht verstehen und weiter laut sind, fällt
Elke wieder in den autoritären Stil zurück und reagiert derart
rigide und willkürlich, daß die Funktionalität der geforderten
Ordnung nicht ersichtlich ist. Die Schüler scheinen sie jedoch nicht
ernst zu nehmen und äffen ihr autoritäres Verhalten nach, so
daß sich gegen Ende der Stunde die Situation derart eskaliert hat,
daß der Unterrichtsstoff vollkommen verlorengeht. Ein Lernprozeß bei
den Schülern ist sehr unwahrscheinlich. Elke verläßt
die Klasse völlig erschöpft.“
Rollenanalyse
Dieser Bericht macht zweierlei deutlich: einmal, wie sich im Verlauf einer Unterrichtsstunde durch Unsicherheit und Verärgerung des Lehrers und durch die Disziplinlosigkeit der Schüler das Klima derartig verschlechtern kann, daß ein effektives Lernen unmöglich wird; zum anderen, daß ein Lehrer auf Dauer eine derartige Belastung psychisch nicht durchhalten kann. Es läßt sich auf Grund des Berichtes leicht vorstellen, daß die Lehrerin die nächste Unterrichtsstunde in dieser Klasse mit noch größerer Unsicherheit beginnen wird und daß die Schüler darauf mit noch größerer Feindseligkeit und Apathie reagieren werden. Ein Teufelskreis schließt sich, der Lehrern und Schülern den Unterricht zur Qual machen kann.
Aus Befragungen von Schülern wird deutlich, daß diese sich beim Lehrer folgende Verhaltensweisen wünschen: Kooperation mit den Schülern, demokratische Haltung, Freundlichkeit, Rücksichtnahme.
Eine Untersuchung von Ruppert erbrachte als Rangfolge von Lehrereigenschaften,
die ihn im Schülerurteil sympathisch machen: Liebe - Güte -
Wohlwollen - Frohsinn - Gerechtigkeit - Verständnis - Ordnung. Schüler
erhoffen sich also einen liebevollen, hilfsbereiten, partnerschaftlichen
Lehrer. Genau diese Einstellungen den Schülern gegenüber haben
sehr viele Junglehrer; sie haben ihren Dienst mit der festen Absicht
angetreten, sich Schülern gegenüber freundlich, partnerschaftlich, „menschlich“ zu
verhalten. Gerade mit diesen Einstellungen aber erleidet der Lehrer häufig
Schiffbruch. Die Schüler scheinen ein großzügigeres,
weniger strafendes, schülerorientiertes Veralten des Lehrers
als Schwäche auszulegen, und sie bestrafen seine guten Absichten
mit Disziplinlosigkeit. Der Lehrer reagiert darauf enttäuscht und
neigt rasch dazu, mit „bewährten“ Zwangsmitteln die
Disziplin wiederherzustellen. Die Aufforderung einzelner Schüler
an den Lehrer „endlich einmal durchzugreifen, sich nicht alles
gefallen zu lassen“, bestärkt den Lehrer dann in seiner Auffassung,
daß die Schüler von ihm eher autoritäres als partnerschaftliches
Verhalten erwarten, daß schulisches Lernen eher ermöglicht
wird, wenn man den Schülern weniger Freiräume läßt.
Der Widerspruch zwischen den Erwartungen und dem Verhalten der Schüler
ist zu erklären durch deren Verunsicherung, die ein Lehrer bewirkt,
wenn er kein typisches Rollenverhalten zeigt. Durch Provokationen und
Disziplinlosigkeiten wollen die Schüler den Lehrer zwingen, doch
die Rolle des „typischen Lehrers“ zu spielen, daß heißt,
sich autoritär zu verhalten, Zwangsmittel anzuwenden.
Die Schüler haben die Schule nun einmal als Zwangssituation kennengelernt:
Klassenarbeiten, Zeugnisnoten, die Frage der Versetzung und Nichtversetzung,
der Numerus clausus u.a. werden vom Schüler als permanente Bedrohung
empfunden, die Angst auslöst. Für diese Angst wird der Lehrer
verantwortlich gemacht, in dem sich die Zwänge des Schulsystems
personalisieren. Ein Lehrer, der versucht, im täglichen Umgang mit
den Schülern weniger Druck auszuüben und die Selbständigkeit
der Schüler anzuregen, muß diesen einerseits unglaubwürdig
erscheinen, da er ja doch nur partiell die Schülerängste vermindern
kann - er ist selbst gezwungen, zu beurteilen, Klassenarbeiten
zu schreiben, Noten zu geben - andererseits stellt er für die Schüler
ein geeignetes Ventil dar, dem sonst vorherrschenden schulischen Druck
auszuweichen, ja sich an ihm als Stellvertreter für das Schulsystem
zu rächen. Durch Disziplinlosigkeit im Unterricht aber wird ein
effektives Lernen verhindert, und die Schülerleistungen sinken.
Damit aber werden die schulischen und beruflichen Chancen der Schüler
verringert, wofür von Eltern und Schülern wieder der Lehrer
verantwortlich gemacht wird, der es nicht versteht, einen guten Unterricht
zu halten. Trotz bester Absichten erlebt der Lehrer eine Kette von Mißerfolgen,
die seine ursprünglichen Einstellungen und Überzeugungen in
Frage stellen und ihn sehr rasch zu Verhaltensänderungen veranlassen
können
Das oben dargestellte Beispiel macht deutlich, wie selbst innerhalb
einer Unterrichtsstunde das ursprünglich eher partnerschaftliche
Verhalten einer Lehrerin in stark autoritäres umschlägt. Die
Kluft zwischen Theorie und Praxis zeigt sich hier ganz konkret. Die Folge
ist eine starke Verunsicherung des Lehrers, der sich aufgrund seiner
ursprünglichen Einstellungen nicht mehr mit seinem eigenen - autoritären
- Verhalten identifizieren kann. Damit empfindet der Lehrer seine Tätigkeit
als entfremdete Arbeit. „Lehrerarbeit ist faktisch entfremdete
Arbeit; den an ihn gestellten bzw. den selbst gestellten Ansprüchen
kann der Lehrer gar nicht gerecht werden. Die Gründe für sein
Scheitern wird er zunächst bei sich selbst suchen. Das ist aber
auf lange Sicht nicht zu ertragen, so daß er sie schließlich
seinen Schülern, von denen er sich enttäuscht sieht und die ‘es
ja gar nicht anders haben wollen’ zuschreibt...“. Ein gegenseitiges
Mißverständnis ist die Ursache für Konflikte zwischen
dem Lehrer und seinen Schülern. „Die Schüler haben die
guten Absichten des Lehrers nicht erkannt, der Lehrer hat die schlechten
Erfahrungen der Schüler mit der Schule nicht richtig eingeschätzt...
. Das Ergebnis ist gegenseitige Enttäuschung.“
Wichtige Vorbedingung dafür, daß der Lehrer an der Schule
nicht verzweifelt, daß er nicht seine berechtigten Überzeugungen
aufgibt, ist daher eine genaue Kenntnis der Ursachen des Verhaltens seiner
Schüler; auf dieser Grundlage wird es ihm möglich sein, zwischen
persönlichen und systembedingten Ursachen von Konflikten zu differenzieren
und eigene Verhaltensunsicherheiten abzubauen. Hier haben - nachdem bisher überwiegend
die Notwendigkeit einer Praxisorientierung betont wurde - theoretische
Veranstaltungen in der Lehreraus- und -weiterbildung einen wichtigen
Platz.